
CITAS Ringvorlesung
Die CITAS-Ringvorlesung richtet sich nicht nur an die Studierenden der Geistes- und Sozialwissenschaften, sondern auch an die breite Öffentlichkeit. Die Vorträge werden von Wissenschaftler*innen der Universität Regensburg und des Leibniz Institut für Ost- und Südosteuropaforschung (IOS) gehalten und bieten auch Gastreferent*innen eine Plattform.
Eine Übersicht über die vorherigen Ringvorlesungen finden Sie unten.

Sommersemester 2022
Frictions and Transformations of Globalization
Montags, 18:15 - 19:45 | H19 (Sammelgebäude)
Motion produces frictions. These have the potential to stall, inhibit or halt shifts. But frictions also release energy, thus producing new movements. Whether in large-scale tectonic shifts or micro-level encounters, interactions between people, technologies, ideas, natural conditions, and the flows of capital and goods shape the diverse, long-term and often contradictory processes termed globalization. It has become apparent that globalization is neither a smooth nor unidirectional process; but rather it is something that undergoes constant challenges, re-direction, and re-appropriation so that its course is neither predictable nor controllable. Nor, for that matter, has globalization led to convergence; rather it has given rise to new divergences across and within countries and continents.
This lecture series focuses on three interlinked elements that are crucial to understanding globality in its diversity across multiple spaces and throughout history: the environment, migration and labor. Drawing on the expertise of colleagues in Regensburg and around the world, the lecture series will offer interdisciplinary perspectives informed by area studies that combine macro-perspectives and critical place-oriented scholarship, in order to highlight the intersections between different scales. Rather than posit a seamless globalization, the speakers highlight the productive and destructive frictions emerging from the interaction and interdependencies between local action and large-scale forces. In this story, natural resources, mobility and human labor are paramount.
The lectures will offer insights on Eastern and Western Europe, North and South America, indicating connections to other world regions and worldwide institutions, as well as highlighting how the global condition is made and remade in local sites and through translocal connections.
Speakers include academics from Regensburg, visiting fellows of the Leibniz ScienceCampus from the USA and Spain, as well as invited guests from Germany and abroad.
Programm
25.07 – Exam / Klausur - multiple choice with short essay
Ringvorlesung 2021/22: Blinde Flecken im Raum
Blinde Flecken im Raum: Das Mittelmeer aus multidisziplinärer und transhistorischer Perspektive
Mittwochs, 16:00-17:30 - Präsenz: H4, Universität Regensburg | hybrid via Zoom. Anmeldung für Studierende über GRIPS und für andere Interessierte über islands@ur.de
20.10.21 Andreas Guidi (Konstanz), Jonas Hock, Laura Linzmeier (Regensburg)
Grundbegriffe der Mediterranean und Area Studies
27.10.21 Rainer Liedtke (Regensburg)
Metamorphose durch Hellenisierung: Thessaloniki und der Große Brand von 1917
03.11.21 Rembert Eufe (Tübingen)
Das veneziano de là da mar
10.11.21 Sonja Brentjes & Victor de Castro y León (Berlin)
Mittelmeerbeziehungen aus der Sicht von See- und Landkarten (14.-17. Jh.) (Vortrag über Zoom mit Übertragung in H4)
17.11.21 Ulrich van Loyen (Siegen)
Trance und Tradition. Erweckungsbewegungen im Italien des 20. Jahrhunderts
24.11.21 Ralf Junkerjürgen (Regensburg)
Der staatenlose Graf von Monte Christo: Insel als Handlungsraum und Symbol im Werk von Alexandre Dumas
01.12.21 Sarah Nimführ (Linz)
(Im)Mobilität und mediterrane Migration
08.12.21 Jasmin Daam (Bonn)
How to see it: Tourism and Space-Formation in the Arab Eastern Mediterranean in the Early Twentieth Century
15.12.21 M’hamed Oualdi (Paris)
Ottoman Legacies in Colonial North Africa (1860s-1920s)
12.01.22 Sebastian Adlung (Hamburg)
Kommunikationsraum Adria: Befunde, Interpretationen, Narrative
19.01.22 Robert Blackwood & Stefania Tufi (Liverpool)
The Mediterranean as a transnational space: a sociolinguistic perspective from France and Italy
26.01.22 Karla Mallette (Michigan) & Daniel König (Konstanz)
Cosmopolitan languages in the Mediterranean: book launch and discussion
02.02.22 Steffen Schneider (Graz)
Die Repräsentation mediterraner Hafenstädte in literarischen Texten der romanischen Literaturen
ZUSAMMENFASSUNG
„Vasto e diverso e insieme fisso“, so beschreibt der italienische Dichter Eugenio Montale die „legge rischiosa“ des Mittelmeers als Metapher für die conditio humana. Das Zitat kann auch als Metapher für die verschiedenen Forschungstraditionen dienen, in denen die Perspektive auf die Mittelmeerregion zwischen Einheit und longue durée einerseits, Fragmentierung und Asymmetrien andererseits schwankt. Wie gehen verschiedene Disziplinen mit einer mediterranen Welt um, die in den Worten von Moatti introuvable (unauffindbar/unerfindbar) ist, und wie begegnen sie der Notwendigkeit, der Bedeutung dieser Weltregion bis in die Gegenwart
gerecht zu werden?
Unsere Ringvorlesung nimmt ausgehend u. a. von Konzepten der Area Studies Themen, Menschen, Kulturen, Sprachen und Räume in den Blick, die bisher eher am
Rande der Mittelmeerforschung standen. Die Beiträge werfen aus mediterranistischer
Perspektive Schlaglichter auf vernachlässigte Phänomene, die auf diese Weise überhaupt erst sichtbar werden und deren breitere Resonanz damit in den Blick rückt. Stellt das Mittelmeer zwischen nationalstaatlich orientierten Ansätzen und der Betonung globaler Verflechtungen eine praktikable Mesoebene dar?
Als Vortragende sind Gäste aus verschiedenen Disziplinen, u.a. Geschichtswissenschaft, Sprach- und Kulturwissenschaften, Kulturanthropologie und Archäologie eingeladen. Die einzelnen Beiträge behandeln dabei Zeiträume, die von der Antike bis in die Gegenwart reichen. Diese breite Perspektive soll der gemeinsamen Diskussion über die Implikationen mediterranistischer Ansätze in der gegenwärtigen Forschungslandschaft dienen.
Die Ringvorlesung wird organisiert von Mitgliedern des CITAS-Netzwerkes MS ISLA an der Universität Regensburg in Kooperation mit der Mittelmeer-Plattform an der Universität Konstanz; sie richtet sich an Studierende, die Fachöffentlichkeit sowie alle weiteren Interessierten und ist als Hybridveranstaltung geplant, die sowohl vor Ort (Regensburg) als auch über Zoom verfolgt werden kann.
Ringvorlesung 2021: Globaler Süden
Sommersemester 2021, Donnerstags, 18-20 Uhr
Area Studies und Raum vom 'Globalen Süden' her neu denken. Post/koloniale Perspektiven und glokale Herausforderungen
Koordinatorinnen: Prof. Dr. Anne Brüske und Joanna Moszczynska
Area Studies sind ein per se interdisziplinärer, bedeutender Forschungsbereich, der fruchtbar dazu beitragen kann, Gesellschaften und Kulturen angesichts historischer und aktueller Globalisierungsprozesse zu verstehen. Allerdings haben die Area Studies auch aufgrund ihrer spezifischen Geschichte auch Kritik an ihren Methoden, Prämissen und Fokussierungen hervorgebracht. Denn trotz der Selbstreflexion der Area Studies angesichts ihres kolonialen und imperialistischen Erbes sind Stimmen aus den Weltregionen unterrepräsentiert geblieben, die traditionell ihr Gegenstand sind: Asien, Afrika und die Amerikas, aber auch Ost- und Südosteuropa. Um Kulturen und Gesellschaften in ihren glokalen Machtgefügen zu verstehen, ist zu fragen, wie Area Studies und Raum aus Sicht des ›Globalen Südens‹ zu konzeptualisieren sind und welche Rolle dabei z.B. virtuelle Räume spielen (können).
Thema der interdisziplinären Ringvorlesung ist insofern eine multiperspektivische Neuausrichtung der Area Studies und ihrer Raumkonzepte im Dialog mit dem ›Globalen Süden‹. Ziel der Veranstaltung ist es, die Notwendigkeit einer Revision bestimmter wissenschaftlicher und kultureller Paradigmen zu verdeutlichen und Wege für dialogische Neukonzeptualisierungen in der Wissensproduktion auszuloten.
Die interdisziplinäre und kulturübergreifende Vorlesungsreihe mit (inter)nationalen Expert*innen umfasst Fallstudien sowie theoretische Beiträge aus Sozialanthropologie, Museumswissenschaft, Geschichtswissenschaft, Soziologie, Linguistik sowie Kultur-, Literatur- und Medienwissenschaft. Neben Spezialist*innen aus Regensburg tragen in der Reihe u.a. vor: Ciraj Rassool (University of the Western Cape, South Africa), Sérgio Costa (Lateinamerika-Institut Berlin), Sinah Kloß (Dependency and Slavery Studies, Universität Bonn), Silke Jansen (FAU Erlangen), Ana Nenadovic (Lateinamerika-Institut Berlin) und Johannes Bohle (Europa-Universität Flensburg).
Die virtuell abgehaltene Ringvorlesung richtet sich an Studierende der Fakultäten SLK und PKGG der Universität Regensburg, an die Fachöffentlichkeit in Regensburg sowie alle weiteren Interessierten.
Programm
Mehr Information zu den einzelnen Vorträgen finden Sie unter den Links in den Titeln. Die Sprache im jeweiligen Titel wird auch die Vortragssprache sein.
15.04.21 | Sinah Kloß (Bonn)
Unmapping the 'Global South': Reflections on a Heuristic Concept
22.04.21 | Ciraj Rassool (Cape Town)
Public history as Counter-Museology: Journeys through Museum Transformation in Africa and Europe
29.04.21 | Anna Steigemann (Regensburg)
The City of the 21st Century, Mobile Spatial Practices, and Glocal Spatial Knowledge: A Spatial Sociology for Multi-Scalar Area Studies
06.05.21 | Silke Jansen & Lucía Romero Gibu (Erlangen)
"Wir" und "Ihr": Sprachwissenschaftliche Perspektiven auf den sozialen Raum im Migrationskontext
20.05.21 | Isabella von Treskow (Regensburg)
Oran, Alger, Sétif: Raumsemiotik bei Hélène Cixous, Kateb Yacine und Mohammed Dib
27.05.21 | Mirja Lecke & Oleksandr Zabirko (Regensburg)
Wie Russland seinen Süden entwarf
10.06.21 | Johannes Bohle (Flensburg)
'Follow-the-Hurricane-Geographies': Geographische Impulse für Area Studies am Beispiel der Karibik
17.06.21 | Ulf Brunnbauer (Regensburg)
Balkan und Südosteuropa, und beyond: Wie eine Region sich selbst sieht
24.06.21 | Sérgio Costa (Berlin)
'Entangled Inequalities': Transregionale Perspektiven auf soziale Ungleichheiten
01.07.21 | Ana Nenadović (Berlin)
Das Internet schlägt zurück: Das Internet als Raum feministischen Widerstands aus dem Globalen Süden
08.07.21 | Andreas Sudmann (Regensburg)
AI Area Studies and the Global South
15.07.21 | Jochen Mecke (Regensburg)
'The Global South goes North': Von "négritude" (Césaire, Senghor) zur "raison nègre" (Mbembe)
Ringvorlesung 2020/21: Special Relations Revisited
Überblick: Ringvorlesung 2020/21 - Special Relations Revisited: Europa und die USA seit dem 19. jahrhundert
In der Ringvorlesung gehen wir der gegenseitigen politischen Verflechtung von Europa (und seinen unterschiedlichen Teilregionen) und den USA seit dem 19 Jh. nach. Das breite Thema der europäisch-US-amerikanischen politischen Ko-Transformation wollen wir entlang folgender Schwerpunkte mit Vortragenden aus Regensburg sowie mit Gästen vertiefen: Außen- und Sicherheitspolitik; Vorbilder und Gegenfolien; Diplomatie und Migrationspolitik; Abgrenzungsdiskurse und Anti-ismen. Dabei wollen wir im Großen und Ganzen chronologisch vorgehen.
Eine Kooperation mit dem Leibniz-Wissenschaftscampus "Europa und Amerika in der modernen Welt"
Wann? Montags, 18:15 - 19:45 Uhr
Wo? Online via Zoom, https://uni-regensburg.zoom.us/j/85892790976, Meeting ID: 858 9279 0976 - keine Anmeldung erforderlich
Programm
2. November | Hedwig Richter (Universität der Bundeswehr, München)
Demokratiegeschichte als nationale Erzählung und transnationaler Prozess. Frankreich, die USA und Deutschland im 19. Jahrhundert
9. November | Ulf Brunnbauer
Amerika-Auswanderung und (ost)europäische „Diasporen” vor dem 1. Weltkrieg
16. November | Volker Depkat
Amerikanische Demokratie als politisches Ordnungsmodell von 1789 bis 1848/49
23. November | Pia Wiegmink
The 'Freedom-Loving German' in America: Negotiating Gender, Antislavery and Immigration in 19th Century German American Women’s Literature
30. November | Dagmar Schmelzer
L'Autre Amérique. Die europäische Wahrnehmung Québecs und des quebecer Separatismus als Alternative zu US-Amerika
7. Dezember | Friederike Kind-Kovács (TU Dresden)
Cotton, Cloth and Milk Powder: Transatlantic Child Relief in post-WWI Central Europe
14. Dezember | Mathias Häußler
Elvis Presley: Wie amerikanisch war Elvis? Die Entstehung einer transatlantischen Popkultur im Kalten Krieg
11. Januar | Klaus Buchenau
Ex occidente lux(us). Religiöse Impulse aus den USA im östlichen Europa des 19. und 20. Jahrhunderts
18. Januar | Katharina Gerund (FAU Erlangen)
Unofficial Ambassadors? Military Spouses in the Transatlantic World
25. Januar | Gerlinde Groitl
Vom amerikanischen Frieden zum Rosenkrieg? Die sicherheitspolitische Beziehungskrise zwischen Europa und den USA
1. Februar | Marlene Laruelle (George Washington University)
Looking at post-Soviet Eurasia from Europe and the US: Divergences of perspectives and shared visions
8. Februar | Abschlussdiskussion
Europa und Amerika 2021 - wohin?
Mit Beiträgen von Prof. Dr. Lora Anne Viola (JFK Institute, Berlin) und Dr. Jana Puglierin (European Council on Foreign Relations - ECFR, Berlin)
Moderation: Dr. Gerlinde Groitl (UR)
15. Februar | Klausur
8. Februar 2021, 18:15
Abschlussdiskussion
Europa und Amerika 2021 - wohin?

Wie geht es weiter mit Europa und Amerika? Dieser Frage widmet sich am 8. Februar 2021 die Abschlussdiskussion der Ringvorlesung „Special Relations Revisited: Europa und die USA seit dem 19. Jahrhundert“. Knapp drei Wochen nach der Amtseinführung von Joe Biden sprechen die beiden Berliner Expertinnen Prof. Dr. Lora Anne Viola (John-F.-Kennedy-Institut) und Dr. Jana Puglierin (European Council on Foreign Relations) mit der Politikwissenschaftlerin Dr. Gerlinde Groitl (Universität Regensburg) über Perspektiven für die transatlantischen Beziehungen. Einschneidende Veränderungen wie das Ende von Donald Trumps Präsidentschaft, der Brexit und Angela Merkels bevorstehender Rückzug aus der Politik stellen das europäisch-amerikanische Verhältnis vor viele offene Fragen, die gemeinsam mit dem Publikum diskutiert werden.
Die Veranstaltung organisieren der Regensburger Leibniz-WissenschaftsCampus „Europa und Amerika“ und der Center for International and Transnational Area Studies (CITAS) der Universität Regensburg. Die bisherigen Vorträge der Ringvorlesung „Special Relations Revisited“ beschäftigten sich mit einem breiten Themenfeld: von historischen Auseinandersetzungen mit Migrationserfahrungen bis hin zur transatlantischen Popkultur und vergangenen Herausforderungen für die Demokratie beleuchteten internationale und Regensburger Expert*innen verschiedenste Aspekte des komplexen transatlantischen Beziehungsgeflechts.
Anne Lora Viola hat die Professur für Außen- und Sicherheitspolitik in Nordamerika am John-F.-Kennedy-Institut der Freien Universität Berlin inne. Sie hat an der University of Chicago promoviert und an der Columbia University studiert. Sie ist Spezialistin für internationale Institutionen, US-Außenpolitik und Weltordnungsfragen. Ihr neuestes Buch The Closure of the International System erschien 2020 mit Cambridge University Press. Sie ist beteiligt am internationalen DFG-Projekt Trust and Transparency in an Age of Surveillance (TATAS), eine Kooperation mit der Jagiellonen-Universität in Krakau, Polen. Sie trägt regelmäßig zu Mediendebatten bei.
Jana Puglierin ist seit Januar 2020 Senior Policy Fellow am European Council for Foreign Relations (ECFR) und Direktorin seines Berliner Büros. Davor war sie Programmleiterin des Alfred von Oppenheim-Zentrums für europäische Zukunftsfragen der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP). Zwischen 2003 und 2010 war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin Schwerpunkt Politikwissenschaft, Zeitgeschichte und Nordamerikastudien an der Universität Bonn, wo sie auch promovierte. Sie trägt zu internationalen und nationalen Mediendebatten bei und veröffentlicht regelmäßig Beiträge in den Reihen des ECFR.
Gerlinde Groitl ist Politikwissenschaftlerin im Bereich Internationale Politik und transatlantische Beziehungen an der Universität Regensburg, wo sie auch promoviert hat. Sie hat auch an der Johns Hopkins University in Washington und der London School of Economics and Political Science (LSE) geforscht. Ihre Schwerpunkte sind die US-amerikanische, deutsche und europäische Außen- und Sicherheitspolitik, die transatlantischen Beziehungen sowie Großmachtbeziehungen, Strategiestudien und Weltordnungsfragen.
ZUSAMMENFASSUNG
In der Abschlussdiskussion „Europa und Amerika 2021 - wohin?“ sprachen Prof. Dr. Lora Anne Viola (John-F.-Kennedy-Institut) und Dr. Jana Puglierin (European Council on Foreign Relations) mit Dr. Gerlinde Groitl (UR) über die Zukunft der transatlantischen Beziehungen. Zunächst gingen sie auf ihre Erwartungen an die Biden-Präsidentschaft ein. Viola analysierte die erste außenpolitische Rede Bidens, in der er betonte, wie wichtig ihm Diplomatie und multilaterale Kooperation sind. Damit zeichnet sich eine Abkehr von Trumps „America First“-Politik ab, dennoch wird Biden aber aufgrund der Coronakrise und verschiedenen strukturellen Problemen primär mit Innenpolitik beschäftigt sein, über die er auch in seiner Rede ausführlich sprach. Puglierin betonte, dass bei aller Erleichterung dennoch Anspannung im politischen Berlin zu spüren sei, da die Wahl wieder relativ knapp ausging und so eine Abhängigkeit von wenigen Swing State-Wähler*innen entstehen könne. Dennoch gibt es in Berlin gute Kontakte zu Bidens Mitarbeitenden. So sieht sie etwa viel Potenzial für die europäische Sicherheitspolitik unter seiner Präsidentschaft. Andere Bereiche, z.B. den Handel, sieht sie eher als problematisch an.
Auf die Frage, ob es noch eine gemeinsame Vision der Amerikaner*innen und Europäer*innen gibt, antwortete Viola, dass es grundsätzlich gemeinsame Werte gibt, jedoch bei der Umsetzung Probleme sichtbar werden. Das Verhältnis zur USA hat sich auch dadurch grundlegend geändert, dass diese heute eine weniger starke Machtposition haben als noch um die Jahrtausendwende. Hier wurde wie in Gerlinde Groitls Vortrag die Rolle Chinas als Spannungsfeld für die transatlantischen Beziehungen genannt. Für Puglierin stellt sich die Frage, ob es den Westen als Modell noch gibt. Sie sieht die nächsten vier Jahre als Chance, den Westen zu stärken, betonte jedoch auch, dass Elemente dieses Konstrukts überdacht werden müssen, so etwa der auf unendliches Wachstum ausgelegte Kapitalismus, der wegen der Klimakrise hinterfragt werden müsse.
1. Februar 2021, 18:15
Marlene Laruelle (Washington DC)
Looking at post-Soviet Eurasia from Europe and the US: Divergences of perspectives and shared visions

While “transatlantic values” have dominated the US-Europe relationship for several decades, the world’s current geopolitical and sociocultural transformations have challenged the previously shared vision of the broader notion of Eurasia. While the US tends now to look at Russia through a “great power competition” prism that is mostly focused on China, Europe offers more diversified policy perspectives, depending on the country and on political orientations. In this lecture, Marlene Laruelle reflects on her ten year experience in Washington DC and her knowledge of American think tank culture and the growing divergences that seem to emerge with many European perspectives on the way to interpret post-Soviet transformations.
Marlene Laruelle - George Washington University
Director, Institute for European, Russian and Eurasian Studies (IERES)
Director, Illiberalism Studies Program
Co-Director, PONARS-Eurasia
Director, Central Asia Program
ZUSAMMENFASSUNG
In ihrem Vortrag über amerikanische und europäische Perspektiven auf Eurasien betonte Marlene Laruelle die Unterschiede in den beiden Sichtweisen. Sie sieht die amerikanische Perspektive als weniger differenziert als die europäische. So wird dort beispielsweise Russland als Verlierer des Kalten Kriegs wahrgenommen, während aus europäischer Sicht kein klarer Gewinner auszumachen ist. Das Think Tank-System in Washington DC spielt eine maßgebliche Rolle in diesen Debatten. Laruelle argumentierte, dass die Think Tanks immer weniger akademisch geprägt sind, sondern stattdessen zunehmend von den beiden Parteien beeinflusst werden. Laut ihr gibt es in Europa keine entsprechende Think Tank-Kultur. Die europäischen Länder teilt sie in Bezug auf Eurasien in vier Gruppen ein: diejenigen, die Russland aus historischen Gründen sehr kritisch gegenüberstehen, diejenigen, die das aus Menschenrechtsgründen tun, neutrale Länder wie Portugal und Spanien und Länder, die Russland eher positiv sehen. Diese Pluralität spiegelt sich auch innerhalb der Parteienlandschaft der einzelnen Länder wider. Ein wesentlicher Unterschied ist auch die geographische Nähe zwischen Europa und Russland, wodurch die beiden besser verbunden sind als die USA und Russland. Der Fokus der USA liegt zudem zunehmend auf China (und Asien im Allgemeinen) sowie Lateinamerika, sodass Eurasien in Zukunft möglicherweise nicht mehr so stark im amerikanischen Fokus stehen wird wie in der Vergangenheit.
25. JANUAR 2021, 18:15
Gerlinde Groitl (UR)
Vom amerikanischen Frieden zum Rosenkrieg? Die sicherheitspolitische Beziehungskrise zwischen Europa und den USA

Die Sicherheit Europas ist seit der Gründung der NATO im Jahr 1949 eine transatlantische Angelegenheit. In historischer Perspektive war für die USA ein solches allianzpolitisches Engagement keineswegs selbstverständlich. Doch letztlich waren es gerade die USA als langfristiger, verlässlicher Sicherheitsgarant, die maßgeblich zum Aufbau einer stabilen Friedensordnung in Europa beigetragen haben. Selbst nach dem Ende des Kalten Kriegs gelang es, das transatlantische Bündnis an neue Herausforderungen anzupassen. Doch in den letzten Jahren dominierte zunehmend der Streit, die Themen reichten von der Lastenteilung im Bündnis, der Bündnissolidarität im Afghanistaneinsatz über den richtigen Umgang mit Russland und die europäischen Fähigkeitslücken. Die Amtszeit von US-Präsident Donald Trump hat das ohnehin angespannte Verhältnis in den vergangenen vier Jahren auf eine weitere harte Probe gestellt. Die Vorlesung beleuchtet die Entwicklung und die Perspektiven der transatlantischen Sicherheitspartnerschaft und ordnet aktuelle Debatten im Gespräch mit dem Publikum ein.
Gerlinde Groitl ist Politikwissenschaftlerin im Bereich Internationale Politik und transatlantische Beziehungen an der Universität Regensburg, wo sie auch promoviert hat. Sie hat auch an der Johns Hopkins University in Washington und der London School of Economics and Political Science (LSE) geforscht. Ihre Schwerpunkte sind die US-amerikanische, deutsche und europäische Außen- und Sicherheitspolitik, die transatlantischen Beziehungen sowie Großmachtbeziehungen, Strategiestudien und Weltordnungsfragen.
Weiterführende Informationen zum Inhalt dieses Vortrags finden Sie in Gerlinde Groitls kürzlich erschienener Veröffentlichung: “Die USA und die transatlantischen Beziehungen: Ende einer Ära?“ Handbuch Politik USA. 2nd ed. Ed. Markus B. Siewert, Christian Lammert und Boris Vormann. Wiesbaden: Springer, 2020. 633-43.
ZUSAMMENFASSUNG
In ihrem Vortrag sprach Gerlinde Groitl darüber, ob die sicherheitspolitischen Probleme zwischen Europa und den USA erst mit Trump entstanden oder auf länger andauernde, strukturelle Probleme hindeuten. Sie sah in der seit dem Kalten Krieg bestehenden transatlantischen Partnerschaft in der Sicherheitspolitik eine zweigleisige Entwicklung: einerseits hat der liberal-westliche Konsens in der Außen- und Sicherheitspolitik Bestand, andererseits gibt es seit den 90ern einen Prozess der Entfremdung. Transatlantizismus kann dabei keinesfalls als Selbstverständlichkeit gesehen werden, da die USA sich bis in 20. Jahrhundert meist von Bündnissen fernhielten. Nach dem Ende des Kalten Krieges gab es bereits unter Bill Clintons Präsidentschaft Spannungen, weil Europa die Erwartungen der USA nicht erfüllen konnte, dennoch gab es gemeinsame Projekte. Mit dem „globalen Krieg gegen den Terror“ unter George W. Bush wurden die Verwerfungen dann heftiger: die USA verzichteten auf NATO-Unterstützung in Afghanistan und der Regimewechsel im Irak sorgte für Spaltung in Europa. Auch unter Barack Obama, dessen Wahl in Europa zunächst Euphorie hervorrief, zeigten sich diese Spannungen, unter anderem in Bezug auf sicherheitspolitische Fragen in Afghanistan sowie in Bezug auf die NATO oder das Handelsabkommen TTIP. Während Trumps antieuropäische Rhetorik also exzeptionell war, geht das angespannte europäisch-amerikanische Verhältnis auf eine längere Geschichte zurück und wird auch unter Biden – obwohl er überzeugter Transatlantiker ist – nicht so schnell gelöst werden. Zudem gibt es auch in Bezug auf die Rolle Chinas bedeutende Differenzen, die in Zukunft eine Rolle spielen werden.
18. JANUAR 2021, 18:15
Katharina Gerund (FAU)
„Inoffizielle Botschafter*innen?“ Ehepartner*innen von Militärpersonal in der transatlantischen Welt

Im Kontext des sogenannten Kalten Krieges begann das US-Militär im großen Rahmen damit, die Ehepartner*innen von stationierten Soldat*innen dabei zu unterstützen, sich ihren Gatt*innen vor Ort anzuschließen. Wie Donna Alvah gezeigt hat, wurden military spouses oft zu „inoffiziellen Botschafter*innen“ der amerikanischen Kultur und agierten so durch die soft power der Diplomatie. Mein Vortrag wird diese Nachkriegsrolle als Ausgangspunkt nehmen und sich auf die (zum Teil) neuen Aufgaben für die Ehepartner*innen seit der Umgestaltung des US-Militärs durch die Abschaffung der Wehrpflicht und besonders im Kontext des „Krieg gegen den Terrorismus“ konzentrieren. Basierend auf der Analyse von verschiedenen kulturellen Repräsentationen von militärischen Ehepartner*innen im 21. Jahrhundert (darunter Magazine, life writing, und fiktionale Darstellungen) zeige ich, wie (transatlantische) Mobilität, Reisen und kulturelle Berührungen den öffentlichen Diskurs über und von military spouses geprägt haben. Doch ich argumentiere, dass die Ehegatt*innen in der kulturellen Vorstellung der USA primär zu inoffiziellen Botschafter*innen in den Staaten wurden, wo ihnen ein doppelter Auftrag zukommt: für die Kriege in Afghanistan und im Irak zu werben und die wachsende „Lücke der Vertrautheit“ (familiarity gap) zwischen der Zivilgesellschaft und der Militärkultur zu überbrücken.
Katharina Gerund (FAU Erlangen-Nürnberg) ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Amerikanistik an der FAU. Zu ihre Forschungsinteressen gehören u.a. Amerikanisierung und kulturelle Mobilität, Gender und Feminismus, und Emotionen und Sentimentalität. Sie ist Koordinatorin des durch das DFG-geförderten „Global Sentimentality Project“.
ZUSAMMENFASSUNG
In Katharina Gerunds Vortrag über die Ehepartner*innen von US-Militärpersonal zeigte sich, dass sich die Rolle der „military spouses“ seit dem Kalten Krieg stark verändert hat. Damals wurden die Partner*innen (meist Frauen) vor allem im Ausland, unter Anderem auch in Deutschland, als inoffizielle Botschafter*innen gesehen, die freiwillig zur Militärgemeinschaft aber auch zum interkulturellen Verständnis mit den Menschen vor Ort beitragen sollten. Ein traditionelles Geschlechterrollenverständnis sorgte dafür, dass sie v.a. als weiblich wahrgenommene Aktivitäten (z.B. Wohltätigkeitsarbeit) durchführen sollten. Für diese Aufgaben gab es eigene Anleitungen und Richtlinien, die Aufgaben wie das Wählen in den USA mit der globalen Ebene verbanden, auf der die Frauen agieren sollten. So sollten sie in Deutschland als Demokratiebotschafterinnen fungieren und dafür sorgen, dass keine Ressentiments gegenüber den Amerikaner*innen entsteht. Im 21. Jahrhundert hat sich diese Rolle stark verändert: nun sollen die Ehepartner*innen v.a. zuhause in den USA die Distanz zwischen dem Militär und der Zivilgesellschaft überbrücken („familiarity gap“), um so amerikanische Militäreinsätze zu legitimieren. Ihr Leben im Ausland wird häufig als touristisches Abenteuer verstanden, was zeigt, dass die Aufgaben gegenüber der lokalen „host community“ in den Hintergrund getreten sind.
11. JANUAR 2021, 18:15
Klaus Buchenau (UR)
Ex occidente lux(us). Religiöse Impulse aus den USA im östlichen Europa des 19. und 20. Jahrhunderts
ABSTRACT
Im 19. Jahrhundert setzte eine massive Auswanderung aus dem östlichen Europa in die USA ein, mit weitreichenden und teils unvorhergesehenen Folgen. Am religiösen Migrationsgeschehen wird sichtbar, dass die Westwanderung - auf verschlungenen Wegen - eine „Veröstlichung“ der religiösen Sphäre im nördlichen Karpatenraum nach sich zog. Menschen, die in habsburgischer Zeit von der Orthodoxie getrennt und über die Union mit Rom dem westlichen Christentum zugeführt worden waren, nutzten die amerikanische Religionsfreiheit zur Wiederentdeckung ihrer orthodoxen Wurzeln. Schließlich brachten sie ihr finanzielles und kulturelles Kapital ein, um in der alten Heimat eine äußerst erfolgreiche Missionsbewegung anzustoßen, in deren Folge Hunderttausende sich in der Ostslowakei und der Karpatenukraine der Orthodoxie zuwandten. Derartige Verflechtungen sind auch heute wieder von Bedeutung - wie etwa das Beispiel orthodoxer Theologie „made in USA“ in der Ukraine zeigt.
ZUSAMMENFASSUNG
In seinem Vortrag im Rahmen der CITAS-Ringvorlesung beschäftigte sich Prof. Klaus Buchenau vom Lehrstuhl für Geschichte Südost- und Osteuropas der Universität Regensburg mit den transatlantischen Impulsen auf die religiösen Identität der Russinen, einer slawischen Volksgruppe, die das Gebiet der Karpartenukraine bewohnt.
Prof. Buchenau begann seinen Beitrag mit einem Überblick über die Geschichte der Russinen. Diese waren im Frühmittelalter Teil der Kiewer Rus, weshalb das Gebiet orthodox geprägt wurde. Im Weiteren Verlauf der Geschichte wurde das Gebiet Teil der habsburger Monarchie unter ungarischer Verwaltung. Da man im Habsburger Reich ein gewisses Misstrauen gegen die Orthodoxie hegte, wurde die Orthodoxe Kirche in der Karpartenukraine in die Unierte Kirche überführt. Diese Kirche war formal Teil des Katholizismus und unterstand Rom, hatte jedoch einige Merkmale des orthodoxen Ritus beibehalten. Die Laien in dem Gebiet bekamen von der Kirchenüberführung so gut wie nichts mit, da die Kirchenunion ihr tägliches Leben und ihre religiöse Praxis kaum beeinflusste.
In den 1870er Jahren erfolgte in Ungarn ein Aufstieg des ungarischen Nationalismus mit starken Assimilierungstendenzen in Bezug auf nicht magyare Bevölkerungen im ungarischen Königreich. Folge war eine große Ausreisewelle aus der Karpartenukraine in die USA. Der Großteil der Russinen wanderte nach Minnesota um dort als Gastarbeiter in der Stahlindustrie zu arbeiten.
Über die Eingliederung der Unierten in die US-Amerikanische Kirchenstruktur herrschte kurz nach dem eintreffen der Russinen eine gewisse Ratlosigkeit. Zuerst wurde versucht Anschluss an die polnische Kirche zu finden, dort lehnte man es allerdings ab einen Gottesdienst nach östlichem Ritus feiern zu lassen. Die übergeordnete Struktur der Katholiken in den USA lehnten ebenfalls eine Eingliederung der unierten Kleriker ab, da diese u.a. das Zölibat nicht einhielten. Nach Zurückweisung der Unierten durch die US-Amerikanischen Katholiken fanden diese sich schließlich in der Struktur der russisch-orthodoxen Kirche in den USA wieder. Unter Einfluss der russischen Kirche in den USA erlebten viele Unierte eine Art orthodoxes Erwachen. Die Unterordnung der unierten Kirch unter Rom wurde abgelehnt und es wurde der Plan gefasst, die Karpartenukraine nach der Heimkehr zu re-orthodoxisieren.
Nach dem Ersten Weltkrieg zerfiel die Habsburgmonarchie. Die Karpartenukraine wurde Teil des neugegründeten tschechoslowakischen Staates. Mit dem Zerfall der Monarchie einher gingen politische Unruhen in der Slowakei, so weigerten sich die Bauern Abgaben an den Unierten Klerus zu zahlen, da man diesem Kollaboration mit dem ungarischen Adel vorwarf. Die aus den USA zurückkehrenden orthodoxen Kleriker fanden damit ein gutes Umfeld für ihre Mission.
Die Orthodoxe Mission in der Karpartenukraine war in großen Teilen Erfolgreich. Besonders im Dorf Becherov, welches eines der ersten Dörfer der Karpartenukraine mit orthodoxer Bevölkerungsmehrheit wurde. Die neu-orthodoxen brachten aus den USA auch wirtschaftliche Methoden zu Finanzierung der Mission mit. So wurde in Becherov die erste orthodoxe Kirche mittels einer Fundraising Kampagne finanziert.
1944 wurden im Zuge der sowjetischen Expansion in dem Gebiet sämtliche religiöse Strukturen (orthodoxe wie unierte) mit der russisch orthodoxen Kirche Zwangsvereinigt.
Klaus Buchenau ist seit April 2013 Professor für Geschichte Südost- und Osteuropas an der Universität Regensburg. Zu seine Forschungsinteressen gehörten u.a. vergleichende serbisch-kroatische Geschichte mit Bezug auf Informalität und Korruption, wie auch Orthodoxie und Katholizismus, und die Geschichte der adligen Familie Thurn-und-Taxis in ehem. Jugoslawien.
14. DEZEMBER 2020, 18:15
Mathias Häußler (Uni Regensburg)
Wie amerikanisch war Elvis? Die Entstehung einer transatlantischen Popkultur im Kalten Krieg

Heute zählt Elvis Presley neben Micky Maus und Coca-Cola geradezu selbstverständlich zu den bedeutendsten popkulturellen Symbolen der Vereinigten Staaten; sein ursprünglicher Aufstieg in den 1950er Jahren war jedoch zutiefst umstritten. Innerhalb der USA wurden Presleys laszive Bühnenauftritte und Adaptionen afroamerikanischer Rhythm and Blues Musik als Provokation des vermeintlichen gesellschaftlichen Konsens in Eisenhowers zutiefst konservativen Amerika wahrgenommen; in anderen Teilen der Welt stand Elvis oftmals synonym für die umstrittene Expansion amerikanischer Massenkultur und Konsumismus vor dem Hintergrund des Kalten Kriegs. Dieser Vortrag beleuchtet die Verwandlung Presleys von einer rebellischen Teenagerfigur zu einem der größten popkulturellen Ikonen der Vereinigten Staaten und untersucht, wie größere Fragen amerikanischer Identität durch die öffentliche Figur des Sängers verhandelt wurden. Er interpretiert Elvis Presley hierbei als Wegbereiter einer transatlantischen Jugendkultur und zeigt, wie Popkultur und Konsumismus das öffentliche Bild der Vereinigten Staaten während des Ost-West-Konflikts beeinflussen konnten.
Mathias Häußler ist Akademischer Rat a.Z. am Lehrstuhl für Europäische Geschichte der Universität Regensburg. Er promovierte an der Universität Cambridge. Sein erstes Buch Helmut Schmidt and British-German Relations: A European Misunderstanding basiert auf seiner Dissertation. Neben seinem Interesse an politischer Geschichte und der Geschichte Internationaler Bezeihungen arbeitet er an den Themenbereichen Popkultur (einschließlich der Figur Elvis Presleys) und Massentourismus im 19. Jahrhundert.
ZUSAMMENFASSUNG
In seinem Vortrag untersuchte Mathias Häußler, wie durch die Ikone Elvis Ideen amerikanischer Identität konstruiert und verhandelt wurden—sowohl innerhalb als auch außerhalb der USA. Die zweigeteilte Präsentation konzentrierte sich zunächst auf Elvis im Amerika der 1950er Jahre, das von Spannungen geprägt war: Das Bild der weißen, konservative Kleinfamilie in den Suburbs und deren Konsum steht der rassistischen Segregationspolitik gegenüber. Vor diesem Hintergrund hatte Elvis 1956 seinen nationalen Durchbruch im Fernsehen, wo er einen starken Kontrast zur konventionellen Unterhaltung der damaligen Zeit darstellte. Seine Auftritte wurden einerseits in Zeitschriften wie dem TIME Magazine als skandalös eingeordnet, andererseits war er gerade unter Teenagern sehr beliebt. Es bildete sich also ein Generationenkonflikt ab, der die Entstehung einer Jugendkultur, die sich gegen die Elterngeneration auflehnt, bedeutete. Besonders an den drei Kategorien class, race, und gender wurden anhand Elvis Fragen amerikanischer Identität verhandelt. Als armer Südstaatler ist galt er als „white trash“, wurde aber genau wegen diesem Hintergrund als authentisch gesehen. Seine Musik wurde wegen des Einflusses von schwarzer Rhythm and Blues Musik zunächst abgelehnt, doch er war bei schwarzen wie weißen Teenagern gleich beliebt. So kann er einerseits als Türöffner gesehen werden oder als jemand der von schwarzer Musik und rassistischen Strukturen profitierte. Zudem wurden Elvis beschuldigt, unschuldige Frauen zu verführen und wurde als unzüchtig gesehen. Trotz alldem wurde das große kommerzielle Potenzial dieser neuen Popkultur erkannt, sodass Elvis zunehmend als Beispiel für den American Dream vermarktet wurde und die vorherigen Kontroversen in den Hintergrund traten.
Im Westeuropa der 1950er Jahre traf die Figur Elvis auf einen anderen Kontext: es gab Debatten über Kapitalismus vs. Kommunismus, den Einfluss der beiden Supermächte und die vermeintliche Amerikanisierung Europas. Seine Popularität wurde dort deshalb als Symptom und Katalysator einer transatlantischen Jugendkultur eingeordnet. Da er nie außerhalb der USA auftrat, kam er in Europa vor allem als mediale Konstruktion an und wurde so zur Aushandlungsfläche von größeren Fragen bezüglich Konsum, Kapitalismus und Jugendkultur. Er wurde aktiv assimiliert und modifiziert, was sich beispielsweise an Musikern zeigt, die versuchen Elvis zu imitieren und mit nationalen Elementen anzureichern (Deutschland: z.B. Peter Kraus). Mit dem Erfolg der Beatles und der Rolling Stones begann dann ein transatlantischer Prozess, der nicht mehr nur als einseitig wahrgenommen wurde.
07.DEZEMBER 2020, 18:15
Friederike Kind-Kovács
Transatlantic Child Relief in post-WWI Central Europe

ABSTRACT
Der Vortrag untersucht transatlantische Kinderhilfsprojekte in Mitteleuropa nach dem ersten Weltkrieg. Am Beispiel von Budapests bedürftigen Kindern rekonstruiert der Vortrag, wie Mitteleuropa nach dem ersten Weltkrieg zu einem Labor für transatlantische humanitäre Intervention wurde. Er untersucht, wie die Kinder der Hauptstadt in den USA humanitäre Empfindungen auslösten, die zu materiellen Hilfen in großem Umfang führten. Die American Relief Administration und das amerikanische Rote Kreuz zeigen beispielhaft das Interesse daran, Tonnen an materiellen ‚Dingen‘ wie Baumwolle, Schuhe und Milchpulver an verarmte und hungernde Kinder in Budapest zu liefern. Der Vortrag beleuchtet, wie transatlantische humanitäre Hilfen für Kinder Bilder des notleidenden Mitteleuropas verstärkten und zugleich mit Vorstellungen der modernen und wohlhabenden Vereinigten Staaten kontrastierten, die nicht nur den ersten Weltkrieg sondern auch diesen Krieg gegen Hunger und Not gewinnen konnten. Durch die Untersuchung von Diskursen und Alltagspraktiken der Hilfsprojekte beleuchtet die Analyse die zwiespältigen Auswirkungen der ‚humanitären‘ Hilfe auf die lokalen Empfängergesellschaften und auf die transatlantischen Machtverhältnisse.
Friederike Kind-Kovács ist Professorin für neuere und neuste Geschichte an der TU Dresden und forscht am Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung. Sie habilitierte sich im Fach Ost- und Südosteuropäische Geschichte an der Uni Regensburg im Mai 2019. Dieser Vortrag nimmt Bezug auf ihr bald erscheinendes Buch: „Budapest's Children: Humanitarian Relief in the Aftermath of the Great War“
ZUSAMMENFASSUNG
In ihrem Vortrag im Rahmen der CITAS-Ringvorlesung beschäftigte sich Friederike Kind-Kovács mit transatlantischen Kinderhilfsprojekten nach dem Ersten Weltkrieg insbesondere den US-amerikanischen Projekten zugunsten der Kinder Budapests.
Kind-Kovács begann ihren Vortrag mit der Feststellung der Gründe für die Hungerkrise in Europa während und nach dem Ersten Weltkrieg. Sie stellte dar, dass es nicht einen einzigen Grund gab, der alleinig für die Nahrungsmittelverknappung verantwortlich gemacht werden kann. Stattdessen haben eine Vielzahl von Gründen wie dem Nahrungsbedarf des Militärs, dem Mangel an Arbeitern in der Landwirtschaft durch den Mannstärke Bedarf der Heere oder die Verwüstung von Agrarflächen durch Kriegsführung kumulativ zu der Krise geführt. In Budapest war außerdem der Verlust bedeutender Agrarflächen durch die Nachkriegsgrenzziehung ein entscheidender Faktor, der zur Hungerkrise führte.
Die Nahrungsmittelknappheit hatte in der unmittelbaren Nachkriegszeit empfindliche Auswirkungen auf die Bevölkerung Ungarns. Teufelskreise aus Hortung, Schwarzmarkthandel und Schmuggel führten zu Unruhen in der Bevölkerung Budapests und hatte auch einen politisch destabilisierenden Einfluss, da auf den Mangel mit Klassenkämpfen, Streiks und Aufständen reagiert wurde. Von März bis August 1919 wurde in Ungarn die Etablierung einer sozialistischen Räterepublik versucht.
Das Leiden der Budapester Zivilbevölkerung (insbesondere der Kinder) wurde in den USA durch die Presse publik gemacht. Berichte wie in der New York Times, in denen Budapest als „Capital of human misery“ bezeichnet wurde, ließen in den USA die Stimmen nach Hilfslieferungen laut werden. Im Februar 1919 wurde die American Relief Administration (ARA) ins Leben gerufen, die sich der Aufgabe annehmen sollte, durch Hilfslieferungen die humanitäre Krise in Europa abzumildern. Ungarn wurde im Sommer 1919, nach Niederschlagung der Räterepublik, in das Wirkungsgebiet der ARA eingegliedert. Mit den Hilfslieferungen verfolgten die Amerikaner auch ein politisches Ziel. Die Abmilderung der Kriegsauswirkungen sollten revolutionären linken Vorhaben der Nährboden entzogen werden.
Die Lieferung und Verteilung der amerikanischen Hilfslieferungen waren eine logistische Herausforderung, die mit den modernsten verfügbaren Transportmethoden (Dampfschiff, Eisenbahn) umgesetzt wurde. Die ARA baute in Budapest eine Verwaltungs- und Verteilungsinfrastruktur bestehend aus Warenhäusern und Küchen auf, um die Verteilung der Hilfsgüter sicherzustellen. In den Wintermonaten wurde das Angebot der ARA auf Kleider- und Schuhspenden ausgeweitet.
Die ARA verwendete ihre Einrichtungen und Güter in Budapest auch um das Image der USA in Ungarn zu verbessern. So waren Nahrungsabgabestationen der ARA mit amerikanischen Flaggen behangen und zeigten Portraits berühmter amerikanischer Persönlichkeiten wie George Washington und der gespendeten Kleidung wurde im Innenfutter eine amerikanische Flagge hineingestickt. Die Öffentlichkeit der Hilfsküchen wurde auch von Seiten der ungarischen Revisionisten mittels Plakaten genutzt, um für die Nichtanerkennung des Vertragen von Trianon zu werben.
30.NOVEMBER 2020, 18:15
Dagmar Schmelzer
L'Autre Amérique. Die europäische Wahrnehmung Québecs und des quebecer Separatismus als Alternative zu US-Amerika

ABSTRACT
Die frankophonen Kanadier, canadiens français, definierten ihre Identität von jeher kämpferisch, im Gestus der Selbstbehauptung eines „petit peuple“ gegenüber den Weiten des amerikanischen Kontinents – und dies naturräumlich wie kulturräumlich, in Konkurrenz zur anglophonen Übermacht im Süden. Die Konfliktlinie frankophon/anglophon bestimmte dabei historisch nicht nur die Abfolge der kolonialen Abhängigkeiten und später die quebecer Politik im Inneren der Provinz und gegenüber Kanada, sondern auch die Frontstellung gegenüber dem U.S.-Einfluss, zumal die Grenze zu den Vereinigten Staaten sich in mancherlei Hinsicht als permeabel erwies. Setzten die Quebecer als „français améliorés“ (Lionel Groulx/Duplessis) dabei traditionell durchaus auf ihr französisches Kulturerbe, ihre „francité“, positionierten sie sich in Einforderung ihrer „américanité“ zunehmend auch als „l’autre Amérique“, ein Amerika, das z.B. in Sachen Sozialpartnerschaft und Wohlfahrtsstaat eigene Standards bevorzugt und auf ein verschiedene Einflüsse und Vorbilder amalgamierendes „modèle québécois“ (Dupuis) als Alternative setzt.
Speziell in den „années 68“, in denen im Zuge von Wertewandel und Protestbewegungen in Québec auch separatistische Stimmen lauter wurden, ist die transnational ausgerichtete, spannungsreiche Selbstpositionierung der Identitätsdiskurse auffallend. Auf der Weltausstellung 1967 in Montréal gibt sich Québec ein welt- und zukunftsoffenes Bild. Viele der Nationalisten, die die Unabhängigkeit der Provinz einfordern, schließen an tiersmondistische und kapitalismus- und damit auch U.S.-kritische Identifikationsmuster an und suchen in transnationalen linken Befreiungsbewegungen Anschluss. Besonders kontrovers, aber auch besonders plakativ, ist Pierre Vallières Bild der Quebecer als „nègres blancs de l’Amérique“, mit dem er im Kampf gegen die soziale Benachteiligung des frankophonen Proletariats den Schulterschluss zur Black-Panther-Bewegung sucht.
Der Vortrag stellt einerseits anhand verschiedener Beispiele dar, wie die quebecer Identitätsbestimmungen in einem transnationalen und transatlantischen Spannungsfeld, zwischen Europa, Francophonie, Drittweltismus und anglophonem Amerika stehen und geht andererseits der Frage nach, ob und wie diese Identität in Frankreich und Deutschland als „anders“ und eigen wahrgenommen wurde.
Dagmar Schmelzer ist Akademische Oberrätin am Institut für Romanistik der Universität Regensburg. Zu ihren Forschungsinteressen gehören Intermedialität, Reiseliteratur und Autobiographien sowie die spanische und französische Literatur seit dem 19. Jahrhundert.
ZUSAMMENFASSUNG
In ihrem am 30.11. gehaltenen Vortrag im Rahmen der CITAS-Ringvorlesung widmete sich Dagmar Schmelzer der Geschichte und der Identität Quebecs.
Schmelzer führte in ihrem Vortrag aus, dass die besondere Identität Quebecs in der Kolonialgeschichte Amerikas begründet ist. Das Gebiet Quebecs war ursprünglich eine französische Kolonie und fiel 1763, nach dem Siebenjährigen Krieg, England zu. Die französische Prägung (französische Sprache und katholische Konfession) der Region blieb allerdings erhalten.
Die Konstruktion der besonderen Quebecer Identität begann im 19. Jahrhundert mit der parallel zu den Entwicklungen in Europa entstehenden Historiographie. Die Quebecer Historiker kreierten ein Geschichtsnarrativ, welches sich durch vornehmlich durch den Kampf der Quebecer Bevölkerung gegen ihnen gegenüberstehende Widrigkeiten auszeichnete. In der Kolonialzeit, so das Narrativ, kämpften die Quebecer gegen die Natur und die Ureinwohner der Region und nach dem Siebenjährigen Krieg gegen die Übermacht der anglophonen Mehrheit in Nordamerika.
Die Quebecer Bevölkerung fühlte sich im Vergleich zu der anglophonen Mehrheit Nordamerikas sowohl kulturell wie wirtschaftlich benachteiligt. Gegen diese Benachteiligung setzten die Quebecer:innen auf kulturelle Gegenprogramme, wie zum Beispiel dem Schaffen eines französischsprachigen Parallelkinos als Gegenoperation zum sich in den 1930er Jahren durchsetzende Hollywoodkino. Durch das Gefühl der wirtschaftlichen Benachteiligung entwickelte sich Quebec außerdem eine stark sozialdemokratisch geprägte politische Kultur, die einen starken Wohlfahrtsstaat nach skandinavischem Vorbild andachte.
Die von der Quebecer Historiographie entworfene Selbsterzählung setzte sich in das 20. Jahrhundert fort und führte vor allem in den 1960er und 1970er Jahren zu einem vom nordamerikanischen Normalfall abweichenden Diskurs in Quebec und auch zu Unruhen in der Provinz. Den Höhepunkt der Unruhen markierte der Oktober 1970 als die linksgerichtete Untergrundorganisation Front de libération du Québec (FLQ) eine Reihe von Anschlägen verübte.
Aufgrund der besonderen Situation der Quebecer:innen nahmen große Teile der Quebecer Öffentlichkeit in dem Umbruchsjahr 1968 linkspolitische Positionen an. So unterstütze man die Bürgerrechtsbewegung in den USA, da man sich aufgrund der eigenen Situation mit der Lage der Afroamerikaner in den USA identifizierte. Des Weiteren nahmen Quebecer:innen antikoloniale und antiimperialistische Positionen und Taktiken an, was sich in einer internationalen Solidarisierung mit u.a. Kuba, Palästina oder Jordaniens äußerte.
23 NOVEMBER 2020, 18:15
Pia Wiegmink
The 'Freedom-Loving German' in America: Negotiating Gender, Antislavery and Immigration in 19th Century German American Women’s Literature - Die freiheitsliebenden Deutschen in Amerika: Gender, Antisklaverei und Immigration in der deutsch-amerikanischen Frauenliteratur des 19. Jahrhunderts
ABSTRACT
Diskurse rund um die Sklaverei haben Vorstellungen vom Eigenen und vom Anderen sowie Prozesse der nationalen und kulturellen Selbstinszenierung stark geprägt. Besonders für deutsche Immigrant*innen in die USA wurden Debatten über die Sklaverei zu einem bedeutenden Forum, um mögliche Pfade hin zur Amerikanisierung auszuhandeln. Gleichzeitig wird die deutsch-amerikanische Präsenz häufig als männliche Erfahrung verstanden. Weibliche Perspektiven auf die Atlantiküberquerung und die Anpassung an und Reflexion über die amerikanische Gesellschaft fehlen in der Historiographie zu deutsch-amerikanische Immigrant*innen häufig noch.
Die Antisklaverei-Literatur von deutsch-amerikanischen Frauen scheint dabei ein besonders geeignetes Mittel zu sein, um nachzuvollziehen, wie deutsche Immigrant*innen ihre Assimilation an die amerikanische Kultur durch ihre Teilhabe an Antisklaverei-Diskursen als Deutsche öffentlich ausgehandelt haben. In meinem Vortrag werde ich zeigen, dass die Ankunft in der Neuen Welt, die Herausforderungen der Assimilation und die Thematik der Sklaverei beliebte Themen der deutschen Immigrantinnenliteratur des 19. Jahrhunderts waren. Deutsche Immigrantinnen leisteten einen tiefgreifenden Beitrag zum Diskurs über die Abschaffung der amerikanischen Sklaverei: als Autorinnen und Protagonistinnen in fiktionalen Antisklaverei-Geschichten, als Journalistinnen, die über die Gleichstellung schwarzer Menschen, die Sklaverei und den Bürgerkrieg schrieben, aber auch als Gesprächspartnerinnen von bekannten Sklavereigegnern wie Frederick Douglass.
Pia Wiegmink ist seit 2019 als Vertretungsprofessorin am Institut für Amerikanistik der Universität Regensburg. Sie promovierte an der Universität Siegen und schrieb ihre Habilitation über amerikanische Antisklaverei-Literatur an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Zu ihren Forschungsinteressen gehören Performance Studies, afroamerikanische Literatur und Kultur und Protestbewegungen.
ZUSAMMENFASSUNG
In ihrem Vortrag sprach Pia Wiegmink über die Verbindungen zwischen dem amerikanischen (Anti-)Sklavereidiskurs und der Literatur von deutsch-amerikanischen Immigrantinnen, wobei ihr Fokus auf Ottilie Assing und Mathilde Franziska Anneke lag. Assing schrieb für deutsche Zeitschriften u.a. Essays über Frauenrechte und Sklaverei, übersetzte Frederick Douglass‘ Buch My Bondage and My Freedom und schrieb auch anonyme Beiträge für Douglass‘ Zeitung. Sie fungierte so als Vermittlerin zwischen den beiden Ländern und beeinflusste die deutsche Wahrnehmung Amerikas. Durch sie lernte der Abolitionist Douglass Deutsche, die nach der gescheiterten Revolution 1848/49 in die USA auswanderten, kennen. Die deutschen Freiheitsbestrebungen wurden in Verbindung mit den Bemühungen zur Abschaffung der Sklaverei gebracht, was zu einem transatlantischen Austausch zwischen deutschen Intellektuellen und amerikanischen Aktivist*innen führte. Die Sklaverei war somit ein wichtiger Teil der deutsch-amerikanischen Selbstdarstellung und beeinflusste deren Assimilation an die amerikanische Gesellschaft.
Besonders deutsche politische Flüchtlinge wurden in der Antisklavereibewegung aktiv - so auch Mathilde Franziska Anneke, die fiktionale Antisklaverei-Texte schrieb und Vorträge zu dem Thema hielt. Die Aktivistin, die sich auch für Frauenrechte einsetzte, entwarf in ihrem Roman Uhland eine utopische Vision, in der die Sklaverei abgeschafft wurde und Afroamerikaner*innen als ideale Representant*innen der amerikanischen Gesellschaft präsentiert werden. Besonders auffallend ist bei Anneke wie auch bei Assing, dass sie racial mixing als positiv darstellen zu einer Zeit, in der viele amerikanische Autor*innen mixed-race Figuren häufig noch mit Stereotypen wie dem der tragic mulatta zeigten. In Assings und Annekes Entwürfen einer Welt der Gleichstellung und interethnic cooperation finden sich aber auch romantisierende und essentialisierende Darstellungen von Afroamerikaner*innen und anderen nicht-weißen Gruppen.
16. NOVEMBER 2020, 18:15
Volker Depkat (UR)
Amerikanische Demokratie als politisches Ordnungsmodell von 1789 bis 1848/49

ABSTRACT
Die Frage nach der Rolle der USA als politisches Vorbild in Europa während der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts und insbesondere von deren "Einfluss" auf die Verfassungsentwicklungen im vormärzlichen Deutschland war ein zentrales Thema der westdeutschen Amerikahistoriographie während des Kalten Krieges. Es hat mit dem Ende des Ost-West-Konflikts aus verschiedenen Gründen dramatisch an Bedeutung verloren, könnte aber von den verflechtungs- und interaktionsgeschichtlichen Fragestellungen einer kritischen Regionalwissenschaft eine neue Relevanz erhalten.
Der Vortrag wird zunächst die Grundlinien der Forschungsdebatte der 'alten Bundesrepublik' über die USA als politisches Ordnungsmodell im Vormärz rekonstruieren, dann nach den Gründen für den Bedeutungsverlust des Themas seit 1991 fragen, um abschließend zu überlegen, welches Potential das Thema "Die Amerikanische Demokratie als politisches Ordnungsmodell von 1789 bis 1848/49" im Kontext einer transnational perspektivierten kritischen Regionalwissenschaft haben kann, die die Geschichte europäisch-amerikanischer Beziehungen als multidirektionale Interaktions-, Verflechtungs- und Transfergeschichte schreibt.
ZUR PERSON
Volker Depkat ist seit 2005 Professor für Amerikanistik an der Universität Regensburg. Er schrieb seine Habilitation an der Universität Greifswald und promovierte in Göttingen. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehört die (US-)amerikanische Geschichte, darunter besonders auch europäisch-amerikanische Verbindungen.
ZUSAMMENFASSUNG
In seinem Vortrag beleuchtete Volker Depkat das oft widersprüchliche Verhältnis Deutschlands zu den USA, die mal als Traum, mal als Albtraum wahrgenommen werden, aber doch immer faszinierend wirken. Dabei ging er zunächst auf die deutsche Amerikahistoriographie vor 1991 ein. Nachdem zunächst vor allem Amerikabilder in der Literatur untersucht wurden, ging es dann zunehmend um den Einfluss der US-Demokratie auf die Entwicklung des demokratischen Denkens in Deutschland. Im Fokus dieser Debatten standen die amerikanische Revolution sowie die Verfassungsdebatten der Paulskirche. Während manche Forscher*innen die USA als liberales Leitbild für die 48er Revolution einordneten, argumentierten andere, dass das politische System der USA eher als Arsenal von Argumenten für die eigenen Absichten diente.
Nach 1991 verlor das Thema aus verschiedenen Gründen an Bedeutung: Die USA und Deutschland entfremdeten sich zunehmend von einander („atlantic drift“) und das wiedervereinigte Deutschland entwickelte eigene Interessen und wandte sich mehr der EU zu. Bei vielen Deutschen machte sich eine Enttäuschung über die amerikanische Demokratie breit. Mit der transnationalen Wende fokussierten sich auch innerakademische Debatten weniger auf Nationalstaaten, sondern bewegten sich hin zu multidirektionalen Verflechtungen, Hybridität und Fluidität. Auch die vielfältigen deutschen Amerikabilder müssen daher als Teil transnationaler Diskurse gesehen werden, die auch andere Länder einbeziehen.
9. NOVEMBER 2020, 18:15
Ulf Brunnbauer (IOS)
Amerika-Auswanderung und (ost)europäische "Diasporen" vor dem ersten Weltkrieg

ABSTRACT
Am 22. März 1908 wurde zum ersten Mal ein orthodoxer Gottesdienst in albanischer Sprache abgehalten – in New York. Der Pope, der damit den ersten Schritt zur Schaffung einer eigenständigen albanisch-orthodoxen Kirche setzte, war Fan Noli – ein umtriebiger Aktivist der albanischen Sache in den USA zu einer Zeit, als es noch keinen albanischen Staat gab. 1922 wurde er schließlich Außenminister des jungen albanischen Staates, 1924 für kurze Zeit zum Regierungschef – bis er den Machtkampf gegen die einheimischen Machtgruppen verlor und Ende 1924 das Land wieder verlassen musste.
Fan Noli ist nicht der einzige Repräsentant von Emigrantengemeinschaften aus Ost- und Südosteuropa in Nordamerika, der die Freiheiten Amerikas für die Agitation für die nationale Befreiung jenseits des Atlantiks nutze. In diesem Vortrag werde ich auf die oft überraschenden Querverbindungen zwischen Emigrantencommunities in den USA und osteuropäischen Nationalismen eingehen und auch die Reaktion von Staaten wie Österreich-Ungarn diskutieren, die darob nicht begeistert waren.
Ulf Brunnbauer ist Direktor des Leibnitz-Institut für Ost- und Südosteuropastudien in Regensburg
ZUSAMMENFASSUNG
Ulf Brunnbauer, Direktor des IOS, hielt die zweite Sitzung der diesjährigen CITAS-Ringvorlesung. Sein Thema war die südosteuropäische Emigration in die USA von Mitte des 19. Jahrhunderts bis zu Beginn des Ersten Weltkrieges, das Verhalten der Emigranten in Amerika und die Einstellung der US-Amerikanischen Gesellschaft zu den Emigranten.
Brunnbauer eröffnete seinen Vortrag mit einer theoretischen Betrachtung des Begriffes der Diaspora. Der Begriff der Diaspora beschreibe demnach in der Migrationsforschung ein dezidiert nationalpolitisches Projekt, welches zum Ziel hat, die Menschen in der Diaspora für die Unterstützung politischer Projekte des Heimatlandes in dem Einwanderungsland einzusetzen. Die Diaspora stellt das Einwanderungsland daher vor besondere Herausforderungen, da die Verbundenheit der Immigrantengemeinde mit dem alten Heimatland und der ausgedrückte Rückkehrwille eine Assimilation der Migranten in die Auswanderungsgesellschaft behindert. In den USA etablierte sich deshalb für die südosteuropäische Immigration zwischen Bürgerkrieg und Ersten Weltkrieg der Begriff der „new immigration“ um diese strukturell von der „settler immigration“ abzugrenzen.
Brunnbauer stellte dar, dass die Erforschung der südosteuropäischen Diaspora in den USA oftmals das Bild einer politisch besonders aktiven Bevölkerungsgruppe malt. Dies sei allerdings nur unter Einschränkungen richtig. Die südosteuropäische Einwanderungsgemeinde in den USA gründete eine reiche Anzahl von Vereinen und Organisationen, von denen nur ein kleiner Prozentsatz das Ziel hatte, politische Projekte im Heimatland zu unterstützen. Bei dem Großteil handelte es sich um konfessionelle Zusammenschlüsse, die sich eher auf Wohltätigkeits- und Kulturarbeit konzentrierten.
Im weiteren Verlauf des Vortrags stellte Brunnbauer die amerikanischen Diasporagemeinden unterschiedlicher südosteuropäischer Länder im Untersuchungszeitraum dar. Die griechische Diaspora war erfolgreich in der Mobilisierung ihrer Auslandsgemeinde, da das griechische Nationsverständnis die Diaspora ideologisch begünstigte. Die Griechen waren es aufgrund ihrer Erfahrungen im Osmanischen Reich gewohnt sich nicht als territorial fixierte, sondern eher als verstreute Nation aufzufassen. Die griechische Diaspora unterstütze Griechenland von den USA aus finanziell und durch Lobbyarbeit.
Aus Ungarn (damals ein autonomer Teil der Habsburgmonarchie, der weitaus größere Teile Europas als das Gebiet Kernungarns inne hatte) wanderten vornehmlich nicht-ungarische Nationalitäten wie zum Beispiel die Slowaken in die USA ein. Begründet kann diese Abwanderungsbewegung aus Ungarn mit den rigiden Homogenisierungsbemühungen der ungarischen Regierung werden. Die ungarische Regierung nahm die als Bedrohung aufgefasste Arbeit der slowakischen Diaspora sehr ernst und neigte dazu ihre Effektivität überzubewerten, weshalb es bei der Sichtung ungarischer Quelle den Eindruck machen kann, als wäre die slowakische Diaspora besonders politisch und radikal gewesen. Auch in diesem Fall gilt es dieses Bild zu revidieren, da die slowakische Gemeinde in den USA in sehr viele, oft konträr zueinander arbeitenden, Kleingruppen zersplittert war, denen meist ihre religiöse Identität wichtiger war als die nationale.
Ein Sonderfall stellte die albanische Diaspora in den USA dar. Im Falle Albaniens formierte sich die Idee einer eigenständigen albanischen Nation, die in Albanien selbst wenig verbreitet war, vornehmlich in Amerika. Ein prominenter albanischer Diasporapolitiker war der orthodoxe Geistliche Fan Noli, der große Mühen auf sich nahm die Idee des albanischen Nationalismus in Amerika zu etablieren. Nach der Unabhängigkeit Albaniens kehrte dieser kurzzeitig dorthin zurück und versuchte dorten ein Modernisierungsprogram umzusetzen. Wie viele Diasporapolitiker, die in ihre alte Heimat zurückkehrten, scheiterte auch Noli mit diesem Unterfangen, da er zwar ein prominenter Exilant war, allerdings nicht Teil der lokalen politischen Elite.
Die letzte Zäsur des Untersuchungszeitraumes stellte der Erste Weltkrieg dar. Dieses Ereignis, welches die südosteuropäische Emigrantengemeinden in den USA stark berührte, sorgte für einen Mobilisierungsschub für die nationalpolitisch orientierte Diaspora in den USA. Viele der Diasporagruppen lobbyierten in den USA für die Auflösung der KuK-Monarchie nach dem Krieg und für die nationale Unabhängigkeit ihrer Heimatländer. Außerdem kam es zu großen Rückreisewellen von Kriegsfreiwilligen nach Europa.
2. November 2020, 18:15
Hedwig Richter (Universität der Bundeswehr, München)
Demokratiegeschichte als nationale Erzählung und transnationaler Prozess. Frankreich, die USA und Deutschland im 19. Jahrhundert

Abstract
Die Wahlsysteme des 19. Jahrhundert führen uns zurück zu den Wurzeln moderner Demokratien. Wie entstanden diese Wahlsysteme, die einen Anspruch auf Allgemeingültigkeit erhoben? Was bedeuteten diese Wahlen für die Männer, die an ihnen teilgenommen haben? Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede bestanden in den drei untersuchten Ländern: Frankreich, Deutschland und den USA? Und was verraten uns diese Vergleiche über die Funktionen von Wahlen und der Demokratie in diesen besonderen Fällen und im Allgemeinen?
Hedwig Richter ist Professorin für Geschichte an der Universität (München). Ihre Forschungsinteressen beinhalten die Geschichte Europas und der USA im 19. und 20. Jahrhundert, Migration und Gender. Ihr kürzlich veröffentlichtes Buch Demokratie. Eine deutsche Affäre ist nominiert für den Bayrischen Buchpreis.
Zusammenfassung
Hedwig Richter von der Universität der Bundeswehr eröffnete mit ihrem Vortrag „Demokratiegeschichte als nationale Erzählung und transnationaler Prozess. Frankreich, die USA und Deutschland im 19. Jahrhundert“ die CITAS-Ringvorlesung. Richter besprach vom frühen 19. Jahrhundert ausgehenden die Entwicklungen der Wahlsysteme und den Ablauf von Wahlen als gesellschaftliches Event in Deutschland, Frankreich und den USA und verglich die Entwicklungen in diesen Ländern zeitlich miteinander. Besonders stellte Richter heraus, dass die Idee der Nation und ihr Fortschritt im 19. Jahrhundert einen erheblichen Einfluss auf die Popularisierung von Wahlen hatte.
Zum Anfang ihres Vortrages stellte Richter heraus, dass in der deutschen Perspektive, vor allem in Hinblick auf die Zeit des Nationalsozialismus, die Nation oftmals zuerst als exklusive Kraft gewertet wird. Das also die Nation in dieser Lesart vor allem den Effekt hatte, die Menschen auszuschließen, die als nicht der Nation zugehörig erklärt wurden. Richter stellte dar, dass dieser Effekt in der Nationalsaatsbildung zwar tatsächlich feststellbar ist, dass die Nation als Idee allerdings auch einen starken inklusiven und egalitären Effekt auf jene hatte, die der Nation zugehörig gezählt wurden.
Richter begann ihren Vortrag mit einer Darstellung der Situation in Preußens. Als Reaktion auf die Französische Revolution hatte Preußen zum Begin des 19. Jahrhunderts eine Reihe von Reformen veranlasst, zu der auch die Einführung eines Wahlrechts gehörte. Diese frühen preußischen Wahlen waren in der Bevölkerung alles andere als beliebt. Durch verschiedene Einschränkungen des Wahlrechts waren nur ca. 3% der Bevölkerung Wahlberechtigt und dieser kleine Anteil der Bevölkerung bleib, trotz Wahlpflicht, den Wahlen zu großen Teilen fern. Richter reflektierte darauf, welches Interesse die Eliten mit der Einführung dieser Wahlen verfolgten und zog, den Schluss, dass die Wahlen zum Ziel hatten, die Bevölkerung an die Administration zu binden. Außerdem sahen die preußischen Eliten nach der Französischen Revolution eine Notwendigkeit ihren Herrschaftsanspruch neu zu Begründen.
Im Weiteren ging Richter auf den Zusammenhang zwischen der Entwicklung der Statistik und den modernen Wahlen ein. Gemäß Richter haben diese beiden Institutionen sich gegenseitig befördert, da die frühen Wahlen den Staaten, mit einer geeigneten statistischen Methode, ermöglichten regelmäßig einen Zensus abzuhalten und andererseits die Entwicklung der Statistik die Abhaltung von modernen Massenwahlen überhaupt erst möglich machte.
Frankreich war das erste europäische Land, welches als Heimat der französischen Revolution ein allgemeines Wahlrecht einführte. Grund war der Umstand, dass in Frankreich die Idee der Nation stark ausgeprägt war und die allgemeine Wahl als Sinnbild dieser Nation angesehen wurde. Das Wahlrecht in Frankreich verkam allerdings, spätestens unter Napoleon, zu einem Akklamationsvehikel der Staatsregierung.
Gegen Mitte des 19. Jahrhundert (vor allem im Rahmen der Revolutionen 1848) fand in Deutschland eine Ausweitung des Wahlrechts statt. Im Vergleich zu den Wahlen Anfang des Jahrhunderts konnte man einen klaren Mentalitätswechsel feststellen. Die Wahlbeteiligung steig deutlich und die Wahlen wurden in einer feierlichen Stimmung zelebriert. Grund dafür, war der Fortschritt der Idee der Nation und der Ausdruck ihrer inklusiven Kraft.
Im Bezug auf die USA ist in der Mitte des 19. Jahrhunderts auch eine Geschlechtergeschichtliche Komponente der Wahl ersichtlich. Die Wahl des US-Präsidenten (bis zur Einführung des Frauenwahlrechts 1920 eine reine Männerangelegenheit) wurde auch kulturell zu einem Ausdruck des zeitgenössischen Bildes von Maskulinität. US-Wahlen wurden unter sehr chaotischen Bedingungen abgehalten und die Teilnehmer waren oft betrunken. Oftmals kam es in Wahllokalen zu Schlägereien.
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde mit der allgemeinen geheimen Wahl das Format geschaffen, welches bis heute in nahezu allen demokratischen Staatssystemen Anwendung findet.
In ihrem Resümee erklärte Richter, dass die Entstehung der Nation als Idee und ihre Durchsetzung eng verknüpft war mit dem demokratischen Fortschritt. Die Nation mit ihrer Idee der Bürgergleichheit machte, in Zusammenspiel mit den allgemeinen Wahlen, die in der französischen Revolution ausgerufene Utopie der Gleichheit zur realpolitischen Wirklichkeit. Dazu bot die Nation eine Quelle der Identität in der modernen Welt. Die Nation fungierte daher im 19. Jahrhundert tatsächlich eine Gleichmacherin innerhalb ihrer Mitglieder, exkludierte allerdings Menschen, die nicht zur Nation gehörig erklärt wurden, umso schärfer.
Ringvorlesung 2019/20: Crisis, what Crisis?
CRISIS - WHAT CRISIS? RInGvorlesung 2019/20- überblick
* Diese Veranstaltung ist offen für alle ** Studierende dürfen sich über LSF anmelden *
Seit 1945 schien die westliche Welt Krisen und Krisenmanagement zu meistern. Der Kalte Krieg und der Fall des Eisernen Vorhangs oder auch die verstärkte wirtschaftliche Globalisierung und deren Folgen waren Krisen, die den westlichen Demokratien nichts anhaben konnten. Im 21. Jahrhundert haben wir es jedoch mit Krisen zu tun, die zur Destabilisierung der Demokratie, der internationalen Ordnung und der öffentlichen Kommunikation in Politik und Gesellschaft führen. Beispiele sind hier die Wirtschaftskrise von 2008, die Nuklearkatastrophe von Fukushima, die sogenannte Migrationskrise von 2015 und die durch die digitalen Medien und Social Media bedingten massiven Manipulationen der Wahlen in den USA und des Brexit-Referendums in Großbritannien. Zudem scheinen die traditionellen Volksparteien an Vertrauen zu verlieren. Doch es gibt auch Krisen, die zu internationaler Solidarität und Zusammenarbeit führen, wie die von der Klimakrise hervorgerufene Fridays-for-Future-Bewegung zeigt.
Die Ringvorlesung interessiert sich für die raumbezogene und transnationale Dimension von Krisen. Die internationale Verflechtung von Wirtschaft und Politik und die Mobilität von Menschen, Ideen und Kulturen haben zur Folge, dass Krisen nicht länger rein nationale Phänomene sind. Stattdessen haben sie regionale, nationale und globale Auswirkungen, die sich gegenseitig beeinflussen und verschiedene gesellschaftliche Bereiche erfassen. Internationale und transnationale Verknüpfungen können so zur Entstehung von Krisen führen oder diese verschärfen, doch sie können auch Lösungen anbieten.
Verschiedene Krisen sowohl aus der jüngeren und der weiter zurückliegenden Vergangenheit werden in der Ringvorlesung aus der Perspektive der International and Transnational Area Studies in ihrer Verflechtung oder aber komparatistisch untersucht. Dabei sind konkrete Fallstudien ebenso gefragt wie eher theoretisch ausgerichtete Beiträge. Programm.
03. FEB 2020
Harriet Rudolph. Migrationskrise? Religionskrise? Narrative der Viktimisierung im Kontext konfessioneller Zwangsmigration im 18. Jahrhundert
 Auch in der Phase der Aufklärung kam es auf dem Boden des Heiligen Römischen Reiches zu Massenvertreibungen von Andersgläubigen. Sie resultierten in der Regel aus politisch-konfessionellen Krisen in den betroffenen Territorien, führten aber andererseits selbst zu Krisenerscheinungen, denn die Menge der Vertriebenen musste untergebracht und versorgt werden.
Auch in der Phase der Aufklärung kam es auf dem Boden des Heiligen Römischen Reiches zu Massenvertreibungen von Andersgläubigen. Sie resultierten in der Regel aus politisch-konfessionellen Krisen in den betroffenen Territorien, führten aber andererseits selbst zu Krisenerscheinungen, denn die Menge der Vertriebenen musste untergebracht und versorgt werden.
In der Frühmoderne besaß der Begriff der Krise semantisch vor allem eine medizinische Konnotation. Die Empfindung einer Krise als Katalysator des Wandels auf politischer Ebene war selten, lässt sich jedoch an Beispielen wie der Salzburger Emigration in den 1730ern weiter erläutern. Im Zuge ihrer Zwangsemigration stellten Protestant*innen vereinzelt Bittschriften an den Reichstag in Regensburg. Sie haben auf Friedensverträge verwiesen, wie den Westfälischen Frieden, weil sie die Rechte der Protestant*innen hätten garantieren sollen. Die Ausweisung protestantischer Lutheraner*innen durch den Salzburger Erzbischof im großen Maße wurde durch in der Zeit florierende Printmedien zu einem Spektakel, das die Massen im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation bediente. Das Bild des „Seufzenden Salzburgers“ wurde so zum Topos der Zeit und verhalf dem Protestantismus, sich dem Katholizismus als moralisch überlegen darzustellen. Auch kam es erst durch die Massenmigration zu einer sekundären Viktimisierung und Sakrifizierung der Vertriebenen. Ging es in Regensburg darum, eine Reichskrise zu vermeiden, mussten die Vertriebenen auf territorialer Ebene angesiedelt werden, wobei sie als Fremde keineswegs überall willkommen waren. Dabei zeigen sich teils ganz ähnliche Probleme, wie sie auch im Kontext aktueller Migrationsprozesse beobachtet werden können. Nichtsdestotrotz kann die Salzburger Emigration aufgrund der Verteilung der Migrierten nicht als Migrationskrise gewertet werden. Zwei Jahrhunderte später, in der Zeit der NS-Herrschaft, kam es dann zu einer Reviktimisierung der Nachkommen der Seufzenden Salzburger.
27. JAN 2020
Sheldon Garon (Princeton) - Moral an der Heimatfront.
Zusammenfassung
 Dieser Vortrag verfolgt die Entstehung des Konzepts der Zivilmoral vom Ersten Weltkrieg bis zum Zweiten Weltkrieg in Europa und Ostasien. Trotz der Ungenauigkeit des Begriffs wurde die “Zivilmoral” zu einem der tödlichsten Diskurse des Jahrhunderts. In ihrem Namen wurden Millionen von Zivilist*innen bombardiert und ausgehungert, als am Krieg beteiligte Länder versuchten, die Moral der Zivilbevölkerung des Feindes zu „brechen“. Ich bespreche die britische „Hungerblockade“ gegen Deutschland; die Stimmungsberichte des Deutschen Kaiserreichs; die deutsche und britische Bombardierung von Städten von 1915-18; Entwicklungen in der „strategischen Bombardierung“ durch die Royal Air Force und die japanische Luftwaffe zwischen den Weltkriegen; das „morale bombing“ von 1940-45; die Stimmungsberichte von Großbritannien, Japan und des NS-Staats; und die „Operation Starvation“ der USA gegen Japan. Wie wurden Versuche, Kriege durch Attacken auf Städte und die „Zivilmoral“ zu gewinnen, „normal“? Ideen und Praktiken, die mit der Moral und der Heimatfront verbunden sind, verbreiteten sich in einem ungemein transnationalen Prozess rasch auf der ganzen Welt.
Dieser Vortrag verfolgt die Entstehung des Konzepts der Zivilmoral vom Ersten Weltkrieg bis zum Zweiten Weltkrieg in Europa und Ostasien. Trotz der Ungenauigkeit des Begriffs wurde die “Zivilmoral” zu einem der tödlichsten Diskurse des Jahrhunderts. In ihrem Namen wurden Millionen von Zivilist*innen bombardiert und ausgehungert, als am Krieg beteiligte Länder versuchten, die Moral der Zivilbevölkerung des Feindes zu „brechen“. Ich bespreche die britische „Hungerblockade“ gegen Deutschland; die Stimmungsberichte des Deutschen Kaiserreichs; die deutsche und britische Bombardierung von Städten von 1915-18; Entwicklungen in der „strategischen Bombardierung“ durch die Royal Air Force und die japanische Luftwaffe zwischen den Weltkriegen; das „morale bombing“ von 1940-45; die Stimmungsberichte von Großbritannien, Japan und des NS-Staats; und die „Operation Starvation“ der USA gegen Japan. Wie wurden Versuche, Kriege durch Attacken auf Städte und die „Zivilmoral“ zu gewinnen, „normal“? Ideen und Praktiken, die mit der Moral und der Heimatfront verbunden sind, verbreiteten sich in einem ungemein transnationalen Prozess rasch auf der ganzen Welt.
AUS DEM VORTRAG
Im Zeitraum vom Ersten bis zum Zweiten Weltkrieg gewann die Heimatfront zunehmend an Bedeutung. Es ging nicht mehr nur um ihre Verteidigung im eigenen Land, sondern zunehmend auch um Angriffe auf die Zivilbevölkerung des Feindes. Dabei spielten drei Faktoren eine wichtige Rolle: Lebensmittelblockaden, die Bombardierung aus der Luft und die Moral der Zivilbevölkerung. Die Moral (oder auch Stimmungslage) wurde damals nicht als etwas Abstraktes, sondern als etwas Messbares angesehen, das entweder zerstört oder erhalten werden konnte. Es wurde versucht, Moral in sogenannten „Stimmungsberichten“ möglichst wissenschaftlich zu dokumentieren.
Die Konstruktion der Moral erfolgte in einem transnationalen Prozess, in dem verschiedene Nationen, darunter Großbritannien, Japan, die USA und Deutschland, sich gegenseitig beobachteten. In der Zeit zwischen den zwei Weltkriegen wurden in mehreren Länder Strategien entwickelt, die sich vor allem auf die Bombardierung beziehen. Ziel der Angriffe sollten laut verschiedenen Berichten Orte mit einer ausgeprägten Arbeiterklasse sein, die dann aufgrund der Attacken Widerstand gegen die eigene Regierung leisten sollte.
Während die britische Bombardierung Deutschlands im Zweiten Weltkrieg nicht zum Sieg führte, war der amerikanische Angriff auf Japan sehr effektiv. Durch Lebensmittelblockaden („Operation Starvation“) und die strategische Bombardierung der Arbeiter*innen wurde zwar kein Aufstand der Japaner*innen erreicht, doch Millionen mussten unter chaotischen Zuständen fliehen.
SHELDON GARON
A specialist in modern and contemporary Japanese history, Sheldon Garon also writes transnational/global history that spotlights the flow of ideas and institutions between Asia, Europe, and the United States. He recently authored “Transnational History and Japan’s ‘Comparative Advantage.'” (link is external) His transnational history, Beyond Our Means: Why America Spends While the World Saves (link is external) (2012), examines the connected histories of saving and spending over the past two centuries in Japan, other Asian nations, Europe, and America.
20. Jan 2020
Christiane Heibach: Zwischen Filter Bubble und Shitstorm. Die sozialen Medien als Krise der Kommunikation?

Während sich John Perry Barlow in seiner „Declaration of Independence of Cyberspace“ 1996 für das Internet noch eine Form der Kommunikation ohne “Privilegien oder Vorurteile” erhoffte, fällt das Urteil von David Baker elf Jahre später ernüchternd aus. Was einst als ein „level playing field“ erträumt wurde, wird heute von wenigen großen Firmen kontrolliert. Durch Überwachung, Kommerzialisierung und Beleidigungen könnte das Web 2.0 gar als eine „Hölle unkontrollierter Kommunikation“ gesehen werden.
Das Web 2.0, also das stark kommunikations- und interaktionsorientierte Internet, scheint geprägt zu sein von negativen Erscheinungen wie Hate Speech und Shitstorms. Doch Hate Speech gibt es nicht nur online. Daher stellt sich die Frage, ob das Medium tatsächlich die Botschaft beeinflusst, wie Robert Habeck vor seinem Rückzug aus den sozialen Medien behauptet hat. Marshall McLuhans einflussreiche Theorie besagt: „Das Medium ist die Botschaft“. Für ihn sind Medien nie nur Technologien, sondern sie ändern immer auch die Gesellschaft, in der sie wirken.
Was macht also die sozialen Medien aus? Eine Besonderheit ist, dass sie ein Hybrid aus Medien der Information (z.B. Zeitung, TV) und Medien der interpersonalen Kommunikation (z.B. Telefon, Email) sind. Außerdem gibt es den sogenannten „online disinhibition effect“, der im Internet sowohl zu Hass und Aggression als auch zu Empathie gegenüber Fremden führen kann.
Angesichts McLuhans Theorie ist die Annahme, dass Hate Speech, Fake News, etc. nur auf das Medium selbst zurückzuführen sind, zu kurz gegriffen. Stattdessen gilt es auch, gesellschaftliche Phänomene wie die zunehmende Affektsteuerung und Fragmentarisierung der Öffentlichkeit in den Blick zu nehmen.
(Text: Simone Schneider)
16. DEZ 2019
Ulf Brunnbauer. Deindustrialisierung und Krisebewusstsein in Südosteuropa
 Ulf Brunnbauer, Direktor des Leibniz Instituts für Ost- und Südosteuropastudien, erforscht die Erfolge und Misserfolge wirtschaftlicher und politischer Transformationen ab 1989 in Südosteuropa, sowie die diesbezüglich gegensätzlichen Haltungen der südosteuropäischen Bevölkerung.
Ulf Brunnbauer, Direktor des Leibniz Instituts für Ost- und Südosteuropastudien, erforscht die Erfolge und Misserfolge wirtschaftlicher und politischer Transformationen ab 1989 in Südosteuropa, sowie die diesbezüglich gegensätzlichen Haltungen der südosteuropäischen Bevölkerung.
Er stellte die Lage der ost- und südosteuropäischen Industrien, Wirtschaften und Gesellschaften 30 Jahre nach dem Zusammenbruch des Kommunismus dar und betonte die Schwierigkeit, mit der postkommunistische Geschichte geschrieben werde, da sich die Art und Weise ständig verändert, in der die jüngste Vergangenheit dargestellt wird. So kam ihm die Frage, ob die anfänglichen Hoffnungen und positiven Ausblicke in der Region trotz des Zusammenbruchs der industriellen und sozialen Strukturen immer noch vorhanden wären. Wenn die Hoffnungen aufgegeben wurden, so nannte Ulf Brunnbauer mit einem besonderen Augenmerk auf (post-)industriellen Orten die Gründe dafür. Er merkte an, dass ein wesentlich größerer Teil der Arbeitenden in der Industrie immer noch arbeitslos ist im Vergleich zu westeuropäischen Ländern, wie beispielsweise ein Drittel aller Tschech*innen und Slowen*innen, aber nur 20% aller Engländer*innen, wobei Deutschland als Ausnahme die Regel nur weiter bestätigte. Der Anteil des BIP erzeugt durch den Industriesektor liegt in Tschechien bei rund einem Viertel, aber bei nur 10% in England, sodass das Gefühl einer postindustriellen Gesellschaft auf beiden Seiten der ehemaligen Mauer nicht unbedingt dasselbe bedeuten muss.
Während die Bevölkerung im Allgemeinen eine höhere Lebenszufriedenheit und bessere Lebensbedingungen genießt, werden jenseits der Statistik Gegenwart und jüngste Vergangenheit stärker in Frage gestellt, weshalb populistische Parteien die Legitimität der Machtübergabe und eine kritische Vergangenheitsbewältigung anfechten. Ähnlich wird durch den Blick auf regionale Unterschiede in einzelnen Ländern deutlich, dass eine ungleiche Verteilung von Wohlstand und Lebenschancen auf dem gesamten Kontinent zu Frust führen, egal ob in Ost-, West- oder Südeuropa. In Osteuropa war dies wesentlich für die Abwanderung, während gleichzeitig eine eher geringe Anzahl von Zuwandernden durch das Gefühl, Verlierer der Transition zu sein, zum Sündenbock wurde. Das Thema der Abwanderung scheint gerade hinsichtlich populistischer Behauptungen bei älteren, weniger mobilen Wähler*innen zunehmend Erfolg zu haben.
9. Dez. 2019
Marina Ortrud M. Hertrampf (Humboldt-Universität Berlin / Universität Regensburg)
Narrative französischer ,Migrations-Krisen‘ seit 2000

Seit der Industriellen Revolution Mitte des 19. Jahrhunderts hat Frankreich eine Reihe von Migrationswellen erlebt. Erstmals krisenhaft wahrgenommen wurde dabei vor allem der Zuzug von Menschen muslimischen Glaubens aus den ehemaligen französischen Kolonien im Maghreb ab den 60er Jahren. Spätestens in den 80er Jahren wird das Thema Migration zu einem der zentralen Themen der französischen Innenpolitik. Seit der marche des Beurs (1983), bei der die Kinder der maghrebinischen Einwanderergeneration gegen rassistische Diskriminierung auf die Barrikaden gingen, und den ersten größeren Wahlerfolgen des Front National kommt es – nicht nur in den Vorstädten – immer wieder zu nationalen Krisen.
Noch vor der sog. ,europäischen Migrationskrise‘ 2015 hat sich die Situation bereits seit der Jahrtausendwende vor dem Hintergrund unterschiedlicher Migrationswellen weiter zugespitzt und zu einer immer restriktiveren Migrationspolitik geführt, die sich einerseits im Umgang mit neuen Migrant*innen und Asylsuchenden zeigt, andererseits aber auch im Verhalten der Sicherheitskräfte gegenüber (jungen) Menschen mit Migrationshintergrund. Eine Folge dieses migrationsbedingten Krisenzustandes waren etwa die Unruhen in den französischen Vorstädten 2005, die europaweit für Schlagzeilen sorgten und ebenso Quellen diverser ,Migrations-Narrative‘ geworden sind wie die menschenunwürdigen Lebensbedingungen in dem sog. Dschungel von Calais oder die Affäre Leonarda, bei der ein Roma-Mädchen in den Kosovo abgeschoben wurde.
Nach einer kurzen Skizze der Migrationssituation in Frankreich seit der Jahrtausendwende werden ausgewählte (semi-)faktuale bzw. (doku-/auto-)fiktionale Migrationsnarrative in unterschiedlichen Medien (Film, Video-Clip, Graphic Novel, Cartoon, Roman und Erzählung) vorgestellt und hinsichtlich ihrer Funktion, Wirkung und Rezeption untersucht.
Zusammenfassung aus dem Vortrag
Frankreich gilt seit der Französischen Revolution als das Land der Menschenrechte, auf welche dieses besonders stolz ist. Doch die wirtschaftliche und politische Legitimationskrise der EU schafft in Frankreich Raum für rechtspopulistische Tendenzen und verstärkt das Bild einer durch Migration ausgelösten Krise. 2008 entstand durch Renaud Camus, Vorreiter der Front National, eine Verschwörungstheorie, die in der Migration einen großen Identitäts- und Kulturverlust Frankreichs sieht, welche durch die Regierung gesteuert als Ziel die Auflösung der Nation Frankreich hätte.
Dabei spielt Migration als beständiger Prozess seit Mitte vergangenen Jahrhunderts eine zentrale Rolle im politischen Diskurs Frankreichs: Ab den 50er Jahren begannen im Zuge der Dekolonialisierung Migrationsbewegungen im größeren Maße, sodass Migration ab den 80ern zum zentralen Thema der Innenpolitik wurde, die eine vollständige Assimilierung der Migrant*innen forderte. Während des march de beaur 83 forderten viele ein Ende dieser rassistischen Diskriminierung. Aber auch in den vergangenen Jahrzehnten äußerten sich Präsidenten wie Jaques Chirac und Nicolas Sarkozy negativ bezüglich Migrant*innen, was sich u.a. in verstärkten Kontrollen nach Terroranschlägen niederschlug. Als Gegenbewegung besetzten so im Sommer 2019 die aus den Gelbwesten entstandenen gilets noirs (Schwarzwesten) das Pariser Pantheon und forderten bessere Bedingungen für migrierte Personen.
Der neokoloniale Rassismus spiegelt sich aber als Krisennarrativ auch in Film und Musik wieder und es entstand durch ständige Migrationsbewegungen eine Art postmigratorischer Rassismus gegenüber neuen Migrant*innen, in denen Franzos*innen mit Migrationshintergrund eine Gefährdung ihres in Frankreich gewonnenen Status sehen und den neuen Migrant*innen deshalb absprechen, genauso französisch zu sein.
(Text: Solveig Albrecht)
02.12.2019, 18:15. H14 (RWS)
Jochen Mecke: Krisennarative in Spanien (und Frankreich)
 Abstract
Abstract
Gemessen an der Endlosgeschichte des Brexit erscheinen die Krisen in Spanien und Frankreich als relativ „normal“. Die Folgen der Wirtschaftskrise von 2008 stellen in beiden Ländern eine zeitlich begrenzte Epoche dar, die eine Reihe von zum Teil gravierenden Problemen mit sich brachten, die jedoch letztlich auch Lösungen auf den Plan gerufen haben. Allerdings gingen beide Länder aus der Krise verändert hervor. In Spanien verschärfte die Wirtschaftskrise die auch schon vorher existierenden Unabhängigkeitsbestrebungen in Katalonien, veränderte das Parteiensystem grundlegend und führte zu einer politischen Instabilität, die auch bei den Wahlen nicht überwunden werden konnte. In Frankreich rief die Krise gleichfalls eine neue politische Bewegung auf den Plan, löste das Links-Rechts-Schema auf und rief als Spätfolge die Bewegung der „Gilets Jaunes“ auf den Plan, deren einjähriges Jubiläum vor kurzem in Paris mit Krawallen und Zerstörungen begangen wurde. Der Vortrag wird die unterschiedlichen Phänomene der Krise in den beiden Ländern analysieren und dabei insbesondere, die unterschiedlichen Formen von Narrativen untersuchen, die die Krise begleiteten, d.h. sowohl die konkreten Erzählungen der Opfer der Krise als auch die großen Metaerzählungen, die die Krisenereignisse in einen größeren Sinnzusammenhang einzuordnen versuchten. Im Vordergrund der Überlegungen wird dabei die Frage stehen, ob es Gemeinsamkeiten zwischen den verschiedenen Krisenerzählungen gibt, was die Besonderheit der neueren Krisennarrative ausmacht, was sie ermöglichen und in welchem Verhältnis sie zu gesellschaftlichen Diskursen stehen.
ZUsammenfassung aus dem Vortrag
Die Weltwirtschaftskrise erhöhte in 2015 die Arbeitslosenquote in Spanien auf 26,1%. Heutzutage ist noch jede*r dritte Jugendliche in Spanien arbeitslos, auch wenn die Gesamtquote sich auf 15% erholt hat. Doch die Krise hat Spanien nicht nur sozial und wirtschaftlich, sondern auch die Politik in zwei Lager gespalten. Während die Partido Popular unter Mariano Rajoy Austeritätspolitik betrieb, erstarkte die linkspopulistische Partei Podemos, sodass aus einem Zweiparteiensystem (PP und PSOE) ein Vier- (Podemos und Ciudadanos) bzw. Fünfparteiensystem (Vox) entstand. Während das Krisennarrativ der spanischen Regierung die Krise als schlechte Lage, aus der man wieder herauskommt, darstellte, beschrieben viele betroffene Spanier*innen ihre Situation als passiv, nicht durch sich selbst beeinflussbar und somit die Handlung der Entlassung als täterlos. Dieses kulturelle Narrativ der Bevölkerung konkurriert mit dem der Regierung, da es dem Narrativ ansonsten typisch weder sinnstiftend noch zielgerichtet ist. Die passive Betrachtung der eigenen Rolle ist hierbei auf eine kulturelle Einstellung der Spanier*innen zurückzuführen, in der die Verteilung von Reichtümern und soziale Netzwerke eine starke Komponente widerspiegeln.
Text: Solveig Albrecht
25.11.2019
Sebastian Teupe (Bayreuth)
Beggar thy Neighbor. Wirtschaftskrisen und Protektionismus in historischer Perspektive
 Historisch ist eine Welt des Freihandels die Ausnahme geblieben. Vor allem die Wahrnehmung wirtschaftlicher Krisen und industriellen Niedergangs haben immer wieder zu unterschiedlich stark ausgeprägten Wellen des Protektionismus geführt. Während sich Großbritannien im 19. Jahrhundert lange Zeit als "Freihandelsnation" verstand und diese Idee im 20. Jahrhundert in Folge steigender Arbeitslosigkeit schließlich aufgab, verabschiedeten sich die USA erst nach dem Zweiten Weltkrieg von einer protektionistischen Handelspolitik und agierten fortan als Vorreiter eines multilateralen Abbaus von Zollschranken. Der industrielle Strukturwandel der 1970er Jahre und Außenhandelsdefizite führten jedoch schon wenige Jahrzehnte später zu einer verbreiteten und politisch instrumentalisierten Freihandels-Skepsis. In Deutschland stand die Idee des Freihandels spätestens seit Friedrich List unter dem Verdacht, den Aufbau eigener Industrien zu verhindern und wurde durch die "Gründerkrise" der 1870er Jahre erschüttert. Erst die langfristig erfolgreiche Integration deutscher Unternehmen in den Weltmarkt bildete ein starkes Gegengewicht zu protektionistischen Forderungen. Die Vorlesung zeichnet diese Entwicklungen mit einem besonderen Fokus auf den Zusammenhang von Wirtschaftskrisen und Protektionismus nach.
Historisch ist eine Welt des Freihandels die Ausnahme geblieben. Vor allem die Wahrnehmung wirtschaftlicher Krisen und industriellen Niedergangs haben immer wieder zu unterschiedlich stark ausgeprägten Wellen des Protektionismus geführt. Während sich Großbritannien im 19. Jahrhundert lange Zeit als "Freihandelsnation" verstand und diese Idee im 20. Jahrhundert in Folge steigender Arbeitslosigkeit schließlich aufgab, verabschiedeten sich die USA erst nach dem Zweiten Weltkrieg von einer protektionistischen Handelspolitik und agierten fortan als Vorreiter eines multilateralen Abbaus von Zollschranken. Der industrielle Strukturwandel der 1970er Jahre und Außenhandelsdefizite führten jedoch schon wenige Jahrzehnte später zu einer verbreiteten und politisch instrumentalisierten Freihandels-Skepsis. In Deutschland stand die Idee des Freihandels spätestens seit Friedrich List unter dem Verdacht, den Aufbau eigener Industrien zu verhindern und wurde durch die "Gründerkrise" der 1870er Jahre erschüttert. Erst die langfristig erfolgreiche Integration deutscher Unternehmen in den Weltmarkt bildete ein starkes Gegengewicht zu protektionistischen Forderungen. Die Vorlesung zeichnet diese Entwicklungen mit einem besonderen Fokus auf den Zusammenhang von Wirtschaftskrisen und Protektionismus nach.
Aus dem Votrag
Sebastian Teupe, Professor für Wirtschaftsgeschichte an der Universität Bayreuth, hielt einen Vortrag über die Langzeitgeschichte des Protektionismus, demnach Freihandel geschichtlich gesehen eine Ausnahme sei. Der zentrale Punkt des Vortrags war die Frage nach dem Grund für den Beziehungswandel zwischen Demokratie und Protektionismus. Bei genauerer Betrachtung dieser Beziehung sind Krisen von herausragender Wichtigkeit; so die Gründerkrise der 1870er, die Weltwirtschaftskrise der 1930er oder auch die Ölkrise der 1970er, sowohl wie die Konsequenzen der Weltfinanzkrise 2008. Krisen würden oft instrumentalisiert werden, um Umbrüche schneller voranzubringen, auch wenn Handlungen in solchen Zeiten ganz besonders schwer zu managen sind. Das lässt jedoch eine Schwächung der Demokratie vermuten, weshalb es fraglich ist, ob eine Hinwendung zum Protektionismus unter verschiedenen historischen Gesichtspunkten in Krisenzeiten notwendigerweise stets zunahm. Verschiedenste Fallbeispiele bezeugen dies, obgleich jedes Mal ein Gegenbeispiel aufgeführt werden kann, dass Protektionismus weder zu einem größeren Wohlstand, noch zu einem besseren Umgang mit den Herausforderungen der Globalisierung und des ständig wachsenden Wettbewerbs weiter verhalf. So vergrößerte sich der Wohlstand der USA nach dem zweiten Weltkrieg beispielsweise erheblich, als sie mit multilateralem Welthandel begannen, während die Wettbewerbsfähigkeit zunahm, wenn japanische Managementmethoden inkorporiert wurden, anstatt sich wie in den 1970er Jahren über wettbewerbswidrige Praktiken zu beschweren. Letztendlich kann Protektionismus aus politischer Sicht zwar Wähler*innenstimmen sichern, ist jedoch keinesfalls den wirtschaftlichen Standards förderlich.
18.11.2019, 18:15. H14 (RWS)
Volker Depkat: American Exceptionalism and the Crisis of Identity in the USA today

Volker Depkat, Professor am Lehrstuhl für Amerikanistik, stellt Teil seiner Forschung zum US-amerikanischen Exzeptionalismus vor.
Zusammenfassung/Abstract
Kurz gesagt ist Amerikanischer Exzeptionalismus, wie Byron Shafer schreibt, die Ansicht, dass „die Vereinigten Staaten anders geschaffen wurden, sich anders entwickelten und daher anders verstanden werden müssen – im Grunde genommen für sich allein und innerhalb des eigenen Kontexts“. Anstatt einer zusammenhängenden, monolithischen und einheitlichen ideologischen Formation ist der Amerikanische Exzeptionalismus eher eine Ansammlung von Mythen, Symbolen und Narrativen, die sich um Begriffe wie „the city upon the hill“, den „American Dream“, „Manifest Destiny“ oder „Land of the Free“ drehen. Der Amerikanische Exzeptionalismus hat daher Narrative der nationalen Identität in den USA in einem kaum zu überschätzenden Ausmaß geprägt.
Die tiefen wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und politischen Veränderungen, die die USA seit der Mitte der 1970er durchgemacht haben, haben jedoch viele der Identitätsnarrative, die aus exzeptionalistischen Überzeugungen heraus entstanden waren, destabilisiert, wenn nicht gar entkräftet. Der amerikanische Präsident Donald Trump hat wiederholt suggeriert, dass der American Dream tot sei, und die Anzahl der US-Amerikaner*innen, die die USA für einzigartig und überlegen halten, ist seit 2002 erheblich gesunken. Die aktuelle Krise des Landes ist daher in hohem Maße eine Krise der Orientierungslosigkeit, die durch die Unsicherheiten über Amerikas angebliche Exzeptionalität entstand.
Dieser Vortrag beschreibt die tiefgehenden Veränderungen, die die USA seit der Mitte der 1970er Jahre erlebt haben (Deindustrialisierung und das Aufkommen der Internetökonomie, Einwanderung und die Pluralisierung von Lebensweisen, die steigende Ungleichheit und die Erosion der Mittelschicht, die sich verändernde Rolle der USA in einem internationalen System, das sich im Wandel befindet) und verknüpft sie mit den Unsicherheiten über die nationale Identität Amerikas.
Zusammenfassung aus dem Vortrag
Studien zeigen, dass immer weniger US-Amerikaner*innen ihr Land für einzigartig und anderen Nationen überlegen halten. Die Mythen, Narrative und Symbole, auf denen der sogenannte Amerikanische Exzeptionalismus basiert, werden also zunehmend infrage gestellt. Daraus resultiert eine Identitätskrise, die seit den 1970ern durch verschiedene Entwicklungen verursacht wird.
In der Politik führten unter anderem politische Skandale und der „War on Terror“ zu einem Vertrauensverlust in Politiker*innen. Zudem verursachten die Ölkrisen der 1970er, die Deindustrialisierung und andere Faktoren zu wirtschaftlichen Problemen. Neben hohen Arbeitslosenzahlen gab (und gibt) es immer mehr schlecht bezahlte Jobs, während gleichzeitig die Reichen immer mehr Geld verdien(t)en. Durch die größer werdende Einkommensschere schwindet der exzeptionalistische Glaube daran, dass harte Arbeit belohnt wird und zu Erfolg führt.
Im gleichen Zeitraum stieg die Diversität des Landes, nachdem die Einwanderungsgesetze 1965 gelockert wurden. Protestbewegungen wie die Bürgerrechtsbewegung der 1960er veränderten zudem den Blick auf exzeptionalistische Narrative wie das „Manifest Destiny“, das auf einer rassistischen Verklärung der Vergangenheit basiert.
Die USA werden fortan nicht mehr als einzigartige, anderen überlegene Nation verstanden, sondern stattdessen als Teil von globalen Entwicklungen betrachtet. Außerdem rücken im Zusammenhang mit Exzeptionalismus nun auch negative „Ausnahmen“ wie die hohe amerikanische Inhaftierungsrate in den Fokus.
(Text: Simone Schneider)
11.11.2019
Anne-Julia Zwierlein. "This was England after all". Die Brexit-Epoche und der Norden Englands als Krisen-Region

Der Vortrag stellt die Frage, ob das Brexit-Votum gezeigt hat, dass Großbritannien eine „divided nation“ ist. Unterschiede zeigen sich sowohl zwischen England und Wales (leave) und Schottland und Nordirland (remain) als auch zwischen ländlichen Gegenden (eher leave) und dem urbanen Raum (eher remain), insbesondere London. Wenn diese Spaltungen allerdings in den Medien und anderswo thematisiert werden, besteht immer die Gefahr, dass diese dadurch auch reifiziert werden.
Das trifft auch auf den englischen Norden zu, in dem viele Geringverdiener*innen sind und öfters niedriger Qualifikationen besitzen. Durch die Deinstrialisierung gehört diese Region zu den ärmsten Bereichen Englands und Westeuropas. Die Wähler*innen dort scheinen unter anderem gegen die britische Politik des Zentralismus, v.a. die Sparpolitik, abgestimmt zu haben. Doch das Klischee des geringverdienenden, ca. 50-jährigen weißen Mannes trifft auf viele Leave-Wähler*innen so nicht zu: oft handelt es sich bei ihnen um „white-collar workers“.
Die Identitätsbildung der Bewohner*innen im Norden Englands wird zum einen durch die Devolution geprägt, durch die mehr Kompetenzen in die Region kommen sollen und diese so besser repräsentiert sein sollen. Zum anderen wirken Elemente wie die Black Country-Hymne, Filme wie Billy Elliot und andere Versuche der Identitätsbildung auf die Identität des Nordens ein.
Seit 2016 wird die Spaltung des Landes auch in der sogenannten Brexit-Literatur thematisiert. In der Condition-of-England novel (z.B. Elizabeth Gaskell’s North and South) findet diese ihren Vorgänger: beide verwenden typischerweise die Perspektive von Südengländer*innen, die mitunter paternalistisch auf die Arbeiter*innen des Nordens blicken. Die Brexit-Romane sind oft von liberalen remain-Wähler*innen geschrieben und finden dann ein gleichgesinntes Publikum („preaching to the converted“).
(Text: Simone Schneider)
4.11.2019, 18:15. H14 (RWS)
Mathias Häußler. Der Brexit als Krise der europäischen Integration? Eine zeithistorische Perspektive
Mathias Häußler, akademischer Rat a.Z. am Lehrstuhl für Europäische Geschichte an der UR, stellt die Rolle Großbritanniens in der Integration und Desintegration Europas vor.
Zusammenfassung
Der Brexit lässt sich nicht einfach als schon immer bestehende Europaskepsis der Brit*innen verstehen. Seit dem Ende des 2. Weltkriegs verlief die Integration Großbritanniens in Europa anders als bei seinen Partnerländern Frankreich und Deutschland. So gab es vor allem in den 60er und 70er Jahren realpolitische Unterschiede wie den wirtschaftlichen und politischen Ausschluss Großbritanniens aus dem Elysee-Vertag oder das Veto von Charles de Gaulle gegen die 2. Bewerbung Großbritanniens für einen Beitritt in die EWG. Zudem fand der Beitritt 1973 bei den Brit*innen weit verbreitete, dennoch keine tiefe Zustimmung, da die Parteien zerstritten und die Wirtschaft durch Krisen erschüttert war, ein Fernhalten aus der EWG aber undenkbar war. Diese Integration in Europa begann sich erst mit der Widervereinigung Deutschlands zu destabilisieren. Während Frankreich eine umfangreiche Integration und Anbindung Deutschlands anstrebte, um es eingedämmt zu halten, verfolgte Großbritannien dies mit Skepsis. Der Verlust großer Teile des Empires hatte außerdem eine kulturelle Neudefinierung seiner einzelnen Teile zur Folge, was insbesondere in England in einer kulturpolitischen Europaskepsis endete. Der Brexit ist daher keinesfallseine seit jeher bestehende Abneigung gegenüber Europa, sondernvor allem einer nie tiefverankerten Integration Großbritanniens in die EU zu schulden.
Aus dem Vortrag
Der Brexit lässt sich nicht einfach als schon immer bestehende Europaskepsis der Brit*innen verstehen. Seit dem Ende des 2. Weltkriegs verlief die Integration Großbritanniens in Europa anders als bei seinen Partnerländern Frankreich und Deutschland. So gab es vor allem in den 60er und 70er Jahren realpolitische Unterschiede wie den wirtschaftlichen und politischen Ausschluss Großbritanniens vom Elysee-Vertag zwischen DE und FR oder das Veto von Charles de Gaulle gegen die 2. Bewerbung GBs für einen Beitritt in die EWG. Zudem fand der Beitritt 1973 bei den Brit*innen weit verbreitete, dennoch keine tiefe Zustimmung, da die Parteien zerstritten und die Wirtschaft durch Krisen erschüttert war, man sich ein Draußen bleiben allerdings nicht leisten konnte. Die langwierige Integration in Europa begann sich erst mit der Widervereinigung Deutschlands zu destabilisieren. Während Frankreich eine umfangreiche Integration und Anbindung Deutschlands anstrebte, um deren Dominanz eingedämmt zu halten, verfolgte GB dies mit Skepsis. Der Verlust großer Teile des Empires hatte außerdem eine kulturelle Neudefinierung der einzelnen Teile GBs zur Folge, was insbesondere in England in einer kulturpolitischen Europaskepsis endete. Der Brexit ist daher keinesfalls eine seit jeher bestehende Skepsis, sondern vor allem einer nie tiefverankerten Integration GBs in der EU und der realpolitischen Faktoren zu schulden.
(Text: Solveig Albrecht)
28.10.2019
Jürgen Jerger. Welche ökonomischen Auswirkungen hat der "Brexit" in Deutschland?

Jürgen Jerger, Professor für Internationale und Monetäre Ökonomik, gab in der Vorlesung einen Ausblick auf die wirtschaftlichen Auswirkungen des Brexits auf Deutschland. Schon vor dem Brexit, welcher zur Zeit des Vortrags noch zum 31.10.2019 möglich war, machten sich seine Konsequenzen in der Wirtschaft spürbar, da Unternehmen sich bereits auf kommende Veränderungen einstellten.
Probleme, die der Brexit für Großbritannien mit sich bringen würde, wurden in der Öffentlichkeit stark diskutiert, während die Auswirkungen auf Großbritanniens Handelspartner*innen weites gehend außer Acht gelassen wurden. Wie tiefgreifend aber wird Deutschlands Wirtschaft betroffen sein? Welche Wirtschaftszweige werden am meisten beeinflusst werden?
Als zweitstärkste Wirtschaft in der EU in 2018 wird ein Brexit spürbar sein, auch wenn es aufgrund des schwierigen Verhandlungsstatus zwischen der EU und GB schier unmöglich ist, genau hervorzusagen, was passieren wird. Bestärkt wird dies auch dadurch, dass die „leavers“ nie eine klare Vision eines Post-EU-Großbritanniens präsentierten, sondern die EU ständig nur zum Buhmann machten.
Ein mögliches Resultat könnte Handelsumlenkung sein, da Länder von der Abwendung Großbritanniens von dem EU-Markt profitieren könnten. Andererseits wären die Profite nur sehr gering, insbesondere auf kurzer und mittellanger Sicht, denn Arbeitsweisen der Unternehmen würden gestört werden, da GB nicht gut genug vorbereitet ist, um die vier Freiheiten des europäischen Binnenmarkts – freier, grenzüberschreitender Waren-, Personen-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr – weiterhin garantieren zu können. Aufgrund globaler Supply-Chains wird der Brexit in manchen Ländern dennoch deutlicher spürbar werden. Bayerns Output wird erwartungsgemäß um 0,12% bis 0,22% fallen, da dieser stark mit der Automobilindustrie verwoben ist. Auf positiver Seite hingegen könnte der Brexit endlich einen Schlussstrich unter den langen, hin und her verschobenen Abschied Großbritanniens ziehen und gleichzeitig Veranlassung einer stärkeren europäischen Integration anderer Länder sein.
Ringvorlesung 2018/19: Jenseits der Nation?
CITAS Ringvorlesung 2018/19: Jenseits der Nation? Überblick
Die Universität Regensburg besitzt eine vielfältige interdisziplinäre Forschungs- und Lehrkompetenz im Bereich der Area Studies zu Ost- und Südosteuropa, Westeuropa und Amerika sowie zu den Verflechtungen zwischen diesen Regionen. Das neu gegründete Center for International and Transnational Area Studies (CITAS) versteht sich als Plattform, um die fächer-, fakultäts- und regionenübergreifende Zusammenarbeit weiter zu fördern. In diesem Sinne bringt die erste CITAS-Ringvorlesung Kolleg*innen aus verschiedenen Disziplinen mit unterschiedlichen regionalen Arbeitsschwerpunkten zusammen, um gemeinsam zwei gegenläufigen Trends nachzuspüren: Die Welt ist heute hochgradig vernetzt und verflochten. Nationalstaaten verlieren unter den Bedingungen der Globalisierung die Fähigkeit, eigenständig Probleme zu bewältigen. Auch nationale Identitäten geraten unter Anpassungsdruck bzw. gehen in transnationalen Zusammenhängen auf. Einerseits ist die Welt also gekennzeichnet von Prozessen der politischen, ökonomischen, rechtlichen, sprachlichen und kulturellen Entgrenzung. Andererseits manifestieren sich zugleich und zunehmend vehement Re-Nationalisierungstendenzen. Dieses Spannungsfeld zwischen der Überwindung des Nationalen und der Rückkehr nationaler politischer Ordnungsmodelle und kultureller Identitäten in Vergangenheit und Gegenwart möchte die Ringvorlesung interdisziplinär und multidimensional ausleuchten. Die Veranstaltung macht damit sowohl die regionalwissenschaftliche Forschungslandschaft als auch die disziplinäre Breite der Area Studies in Regensburg sichtbar.
CITAS Ringvorlesung, 15. Oktober 2018, 18-20 Uhr
Gerlinde Groitl: Area Studies an der UR und CITAS.
Aufbau und Ziele der Ringvorlesung
 Im Rahmen der CITAS Ringvorlesung „Jenseits der Nation? Internationale und transnationale Ordnungen" hat Dr. Gerlinde Groitl am 15. Oktober einen einführenden Vortrag gehalten. Dabei stellte sie das CITAS als neues Zentrum für Internationale und Transnationale Area Studies und Regensburg als idealen Standort für regionalwissenschaftliche Forschung vor.
Im Rahmen der CITAS Ringvorlesung „Jenseits der Nation? Internationale und transnationale Ordnungen" hat Dr. Gerlinde Groitl am 15. Oktober einen einführenden Vortrag gehalten. Dabei stellte sie das CITAS als neues Zentrum für Internationale und Transnationale Area Studies und Regensburg als idealen Standort für regionalwissenschaftliche Forschung vor.
Im Zuge ihres Vortrags betonte Groitl, dass es sich bei Area Studies um ein Fachgebiet handelt, das die Verbindungen und Beziehungen zwischen Akteuren in Regionen mit unterschiedlichen Maßstäben untersucht, von der lokalen Region über die Nation bis hin zu umfassenderen regionalen Bereichen. Dr. Groitl wies auf die Multi- und Interdisziplinarität der Area Studies hin, was sich in ihrem Ausblick auf die bevorstehenden Vorträge der CITAS-Ringvorlesung widerspiegelte.
Dr. Gerlinde Groitl ist Akademische Rätin a. Z. an der Professur für Internationale Politik und transatlantische Beziehungen der Universität Regensburg. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind die US-amerikanische, deutsche und europäische Außen- und Sicherheitspolitik, die westliche Interventionspolitik sowie Großmachtbeziehungen und Weltordnungsfragen.
CITAS Ringvorlesung, 22. Oktober 2018, 18-20 Uhr
Ulf Brunnbauer: Anti-Balkanisierung: Föderalismuskonzepte in Südosteuropa im 19. und 20. Jahrhundert
Im Rahmen der CITAS Ringvorlesung „Jenseits der Nation? Internationale und transnationale Ordnungen“ hat Prof. Dr. Ulf Brunnbauer am 22. Oktober einen Vortrag über Föderalismuskonzepte im 19. und 20. Jh. gehalten. Er bot eine kritische Neubewertung des Balkanisierungskonzeptes im historischen Kontext.
Er skizzierte die vielfältigen Bemühungen um die Bildung von Föderationen und Bündnissen von Nationen in der Region Südosteuropas, insbesondere im postimperialen Kontext. Er differenzierte zwischen der französischen Idee eines zentrierten Föderalismus und der deutschen, ethnisch orientierten Interpretation der Föderalismusidee und betrachtete, wie diese in der jeweiligen Region umgesetzt wurden (oder nicht umgesetzt werden konnten). Ein besonders interessanter Einblick in die Art und Weise, wie Nationbuilding und Konzepte des Föderalismus parallel verliefen, wobei – zumindest theoretisch - kleinere Nationen oftmals nach Stärke strebten. Er verfolgte die Geschichte der föderalen Ideen bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg unter dem Kommunismus zurück und verwies auf die Spannungen, die sich beispielsweise mit der Sowjetunion hinsichtlich der angestrebten stärkeren Integration Jugoslawiens mit Bulgariens entwickelten. Diese Idee einer pragmatisch-diplomatischen Föderation scheiterte letztendlich an Spannungen im kommunistischen Block, wobei die jugoslawische Bewegung als Herausforderung für den eigenen internationalistischen Föderalismus der Sowjetunion wahrgenommen wurde.
Ulf Brunnbauers Vortrag bot eine regionale Perspektive auf das globale Phänomen des Föderalismus und bot gleichzeitig ein Bild von der Balkanregion, das seiner typischen Vorstellung von einem von Zersplitterung und Konflikt geprägten Gebiet widerspricht.
Prof. Dr. Ulf Brunnbauer ist Direktor des Instituts für Ost- und Südosteuropaforschung (IOS), Ko-Sprecher der Graduiertenschule für Ost- und Südosteuropastudien, Professor für Geschichte Südost- und Osteuropas, Universität Regensburg und Mitglied des CITAS Vorstands.
CITAS Ringvorlesung, 29. Oktober 2018, 18-20 Uhr
Michael Khodarkovsky. Was Russia "Ahead" of Europe? Russia's Colonial Experience in Comparative Perspective
 Dieser Vortrag argumentierte, dass das Russische Kaiserreich tatsächlich eine Kolonialmacht gewesen ist und sich der russische Staat weigerte, seine Osterweiterung als koloniale Expansion zu definieren. Prof. Khodarkovsky betrachtete Russlands koloniale Erweiterung im Vergleich zu anderen Imperien und dass das Vordringen in die Gebiete des Kaukasus, Zentralasiens und Sibiriens bereits im 16. Jahrhundert ein erster staatlich geführter und staatsaufbauender Versuch gewesen war. Die staatlich organisierte Kolonialisierung Russlands, die in der frühen Neuzeit zahlreiche Völker eroberte, unterschied sich von Praktiken, die von anderen europäischen Mächten bekannt sind. Russland war dabei anderen Imperien voraus, die diesen Ansatz erst im 19. Jahrhundert übernahmen. Prof. Khodarkovsky konzentrierte sich insbesondere auf die vermittler aus der lokalen Bevölkerung, die das russische Kolonialprojekt durch kulturellen Austausch und Kontakt erleichterten.
Dieser Vortrag argumentierte, dass das Russische Kaiserreich tatsächlich eine Kolonialmacht gewesen ist und sich der russische Staat weigerte, seine Osterweiterung als koloniale Expansion zu definieren. Prof. Khodarkovsky betrachtete Russlands koloniale Erweiterung im Vergleich zu anderen Imperien und dass das Vordringen in die Gebiete des Kaukasus, Zentralasiens und Sibiriens bereits im 16. Jahrhundert ein erster staatlich geführter und staatsaufbauender Versuch gewesen war. Die staatlich organisierte Kolonialisierung Russlands, die in der frühen Neuzeit zahlreiche Völker eroberte, unterschied sich von Praktiken, die von anderen europäischen Mächten bekannt sind. Russland war dabei anderen Imperien voraus, die diesen Ansatz erst im 19. Jahrhundert übernahmen. Prof. Khodarkovsky konzentrierte sich insbesondere auf die vermittler aus der lokalen Bevölkerung, die das russische Kolonialprojekt durch kulturellen Austausch und Kontakt erleichterten.
In einer anschließenden lebhaften Diskussion argumentierte Prof. Khodarkovsky, dass die westliche Expansion Russlands ab dem späten 18. Jahrhundert nicht als kolonial betrachtet werden könne, sondern ein imperiales Machtspiel gewesen sei. Dies sei darauf zurückzuführen, dass Russland sich selbst nicht als kulturell überlegen erachten könnte. Solch eine Haltung ist jedoch eine notwendige Voraussetzung für koloniale Eroberung. Des Weiteren meinte er, dass das koloniale Unterfangen Russlands langfristige Konsequenzen für die russische Identität und Politik gehabt habe. Putins Politik stelle dabei eine Wiederbelebung der imperialen Denkweise dar, in der Russland seine Größe gegenüber internationalen Konkurrenten behaupten möchte.
Lebenslauf
Michael Khodarkovsky ist Professor für Geschichte an der Loyola University Chicago. In seiner Forschung und Lehre hat er sich auf das Russische Kaiserreich, komparative Imperialstudien, Kolonialismus und Beziehungen zur westlichen Kultur spezialisiert. In seinen ersten Publikationen untersuchte er die imperiale Expansion Russlands und die dadurch entstehenden Begegnungen mit nichtchristlicher Bevölkerung. Sein aktuelles Projekt untersucht die Praktiken des Russischen Kaiserreichs im Vergleich zu anderen eurasischen Imperien. Prof. Khodarkovsky hat weltweit an zahlreichen Universitäten und Institutionen gelehrt, u.a. an der Central European University in Budapest, der Humboldt-Universität zu Berlin, Peking, Göttingen, Cambridge und dem University College London. Seine Bücher wurden in mehrere Sprachen übersetzt, darunter Russisch, Türkisch und Polnisch.
CITAS bedankt sich recht herzlich bei Prof. Guido Hausmann für die Einführung und Leitung der Diskussion.
CITAS Ringvorlesung, 05. November 2018, 18-20 Uhr
Volker Depkat: American Exceptionalism und die Traditionen
U.S.-amerikanischer Außenpolitik
Der Vortrag hat zunächst American Exceptionalism als eine sozial konstruierte Vorstellungswelt in ihren wesentlichen Elementen rekonstruiert und dabei insbesondere auch deren räumliche Dynamik reflektiert. Anschließend wurde dann gezeigt, wie Narrative des American Exceptionalism zur Rechtfertigung von ganz unterschiedlichen, teilweise richtiggehend konträren außenpolitischen Strategien herangezogen wurden. Die verschiedenen Ansätze pendelten zwischen der Expansion, insbesondere in durch Spanien beeinflussten Gebieten des ausgehenden 19. Jahrhunderts, und einem Selbstschutz. Die Befürchtungen eines Zusammenbruchs der eigenen Exzeptionalität war für die Unterstützung beider Ansätze von grundlegender Bedeutung. Der Kern des Vortrags war die Erörterung der exzeptionalistischen Grundlagen der Politik des „Demokratischen Internationalismus“ im 20./21. Jahrhundert, mit der die USA es sich zur Aufgabe machten, ihren Way of Life in alle Welt zu exportieren, um die eigene Demokratie zu schützen. Damit organisierte der Demokratische Internationalismus eine Perspektive auf das internationale Mächtesystem, die Konflikte als Systemantagonismen zwischen Demokratien und Anti-Demokratien interpretierte. Daran strukturell gekoppelt waren spezifische Feindbilder, die sich weniger auf andere Staaten und Nationen bezogen, sondern auf weitgehend enträumlichte „Ideologien“.
Dem Vortrag folgte eine lebhafte Diskussion, die Prof. Depkat dazu brachte, den amerikanischen Exzeptionalismus in Bezug zu anderen nationalen Formen des Exzeptionalismus zu diskutieren. In der Debatte wurde auch das Verhältnis von Donald Trumps Politik zum Exzeptionalismus und die amerikanisch-russische Beziehung beleuchtet.
Prof. Dr. Volker Depkat ist seit 2005 Professor für Amerikanistik an der Universität Regensburg und aktuell Dekan der Fakultät für Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften. In seiner Forschung beschäftigt er sich vorrangig mit der Geschichte Nordamerikas von der Kolonialzeit bis zur Gegenwart und der Europäisch-amerikanischen Beziehungen von der frühen Neuzeit bis heute.
CITAS Ringvorlesung, 05. November 2018, 18-20 Uhr
Natali Stegmann: Internationale Organisationen: Das 20. Jahrhundert zwischen Nation, Europa und Welt aus der Perspektive Ostmitteleuropas
Neben dem Versailler Vertrag, der vor 100 Jahren als Folge des Ersten Weltkriegs gegründet wurde, wurde auch der Völkerbund, die Vorgängerorganisation der Vereinten Nationen, ins Leben gerufen. Die Etablierung eines „Weltparlaments“ verfolgte dabei die Wilson-Idee einer Versöhnung von freier Marktwirtschaft und sozialer Gerechtigkeit. Diese liberale Utopie wurde auch nach dem Zweiten Weltkrieg in erneuerten Bemühungen um Frieden zu sichern wieder aufgegriffen. Deren Entfaltung im Spannungsfeld von europäischen Werten und globalem Anspruch wurde in dem Vortrag näher beleuchtet, auch hinsichtlich des Verhältnisses der Europäischen Union zur globalen Ordnung. Sie bezog sich auf die Grundidee, dass internationale Organisationen von Nationalstaaten verlangen, dass sie ein gewisses Maß an nationaler Souveränität aufgeben, um diese Souveränität langfristig zu erhalten. Die Tatsache, dass Genderfragen mit der Entstehung der neuen internationalen Ordnung zusammenhängen, war ein weiterer Grundpfeiler ihres Vortrags.
CITAS freut sich ganz besonders über den Besuch einer Gruppe Schüler*innen der 12. Klasse der Pindl-Schule, die gemeinsam mit ihrem Lehrer Werner Schottenloher den Vortrag von Natali Stegmann besuchte. Die Klasse befasst sich momentan mit internationalen Beziehungen und konnte anhand des Vortrags Einblicke in die Frage erhalten, wie das Fach historisch und transnational an der Universität untersucht werden kann. Des Weiteren stellte Paul Vickers den Schüler*innen die verschiedenen internationalen und binationalen Studienprogramme in Regensburg vor, um ihnen Inspiration für ihre akademische Zukunft zu geben.
Apl. Prof. Dr. Natali Stegmann ist seit März 2009 Wissenschaftliche Koordinatorin für Osteuropaforschung und stellvertretende Frauenbeauftragte der Fakultät für Philosophie, Kunst-, Geschichts- und Gesellschaftswissenschaften. Sie lehrt und forscht zur Geschichte Ostmitteleuropas, besonders Polens und der böhmischen Länder, der Geschlechter- und Kulturgeschichte, Sozial- und Nachkriegspolitik im 20. Jahrhundert und dem Spätsozialismus.
CITAS Ringvorlesung, 19. November 2018, 18-20 Uhr
Hubert Pöppel: Lateinamerika: woher - wohin?
Nachdem Lateinamerika im frühen 19. Jahrhundert die Unabhängigkeit erlangt hatte, zerbrach sehr schnell der Traum des „Befreiers“ Simón Bolívar, geeinte und untereinander kooperierende Großregionen etablieren zu können. Stattdessen bildete sich eine Vielzahl von Staaten heraus, die sich zunächst einmal als Nationalstaaten konsolidieren mussten. Erst im 20. Jahrhundert kam es zu vielfältigen, allerdings zumeist wenig erfolgreichen Initiativen der lateinamerikanischen Länder, auf politischem und wirtschaftlichem Gebiet zusammenzuarbeiten. Sehr viel fruchtbarer waren hingegen die Ansätze der Intellektuellen, länderübergreifende Identitäten zu bestimmen und letztlich über Lateinamerika als Großregion mit gemeinsamer kultureller Spezifika, die gleichzeitig Unterschiede innerhalb bestimmter Räume aufzeigen, zu reflektierten.
Prof. Dr. Pöppel gab einen faszinierenden Einblick in die Nationenbildung in Lateinamerika, die zeitgleich in Europa stattfand und übertrug und transformierte dabei die kulturellen und politischen Modelle, welche die Grundlage für den Aufbau imaginierter Gemeinschaften bildeten. So wurden dafür zum Beispiel Poesie und Literatur genutzt, ohne jedoch zwangsläufig eine starke Differenzierung von den Nachbarstaaten zu betonen. Sein Vortrag skizzierte auch die langfristigen Konsequenzen dieser Art von Nationenbildung, einschließlich einer verstärkten Tendenz zu Bürgerkriegen und weniger zu grenzüberschreitenden Konflikten. Der Vortrag wies auf die Vielfalt der heutigen Regionen hinsichtlich ihrer politischen Ordnung und ihrem Umgang mit der indigenen Bevölkerung hin, ein Thema, das auch in der anschließenden Diskussion wieder aufgegriffen wurde.
Apl. Prof. Dr. Hubert Pöppel lehrt und forscht am Institut für Romanistik der Fakultät für Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften und ist seit 2007 Geschäftsführer des Forschungszentrums Spanien der Universität Regensburg. Sein Forschungsschwerpunkt liegt auf lateinamerikanischer und iberoromanischer Literatur- und Kulturwissenschaft.

CITAS Ringvorlesung, 26. November 2018, 18-20 Uhr
Jürgen Jerger: Ist die Globalisierung am Ende? Zum Verhältnis ökonomischer und politischer Rationalität

Die weltwirtschaftliche Integration bzw. konkreter: der grenzüberschreitende Güterhandel hat nach dem Ende des zweiten Weltkriegs fast kontinuierlich zugenommen. Vor allem deshalb wird die Globalisierung häufig als quasi naturgesetzliche Entwicklung (miss-) verstanden. Ich will zunächst zeigen, dass dies sowohl sachlogisch als auch vor dem Hintergrund historischer Entwicklungen schlicht falsch ist. Die aktuellen Angriffe auf Freihandel bspw. durch die Trump-Administration sind insofern nichts Neues.
In einem zweiten Teil des Vortrags wurde mit Hilfe spieltheoretischer Überlegungen deutlich gemacht, unter welchen Bedingungen politische Akteur*innen eine eher liberale bzw. protektionistische Handelspolitik wählen. Anhand der Methode des Nash-Gleichgewichts wurde gezeigt, dass die Wahrnehmungen politischer Akteure, die wiederum von deren Affinität zu bestimmten Interessensgruppen innerhalb ihres Landes abhängen können, von entscheidender Bedeutung sind. Gleichzeitig wird dabei jedoch versucht, das Verhalten der anderen am Handel beteiligten Partei zu berücksichtigen.
Jürgen Jerger bot einen faszinierenden Einblick nicht nur in die Geschichte und den aktuellen Stand der Globalisierung, dessen Multilateralismus in Gefahr zu geraten scheint, sondern auch in die Methoden, die bei der Wirtschaftsforschung angewendet werden, darunter statistische Analysen und die Spieltheorie. Er zeigte eine globale Perspektive auf, indem er sich seinem Fachbereich der Handelsbeziehungen zwischen den USA, Deutschland und Osteuropa widmete. Er argumentierte, dass sich die Handelspolitik immer zwischen Freihandel und Protektionismus bewege und daher eine gewisse Sorge bezüglich Trump oder China, die beiden Hauptakteure der lebhaften Diskussion, überbewertet seien.
Prof. Dr. Jürgen Jerger leitet den Lehrstuhl für Internationale und Monetäre Ökonomik der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und war von 2007 bis 2017 nebenamtlich als Direktor am Leibniz-Institut für Ost-und Südosteuropaforschung Regensburg tätig. Seine Forschungsschwerpunkte liegen auf Internationaler Ökonomik, Monetärer Ökonomik und Arbeitsmärkten.

CITAS Ringvorlesung, 03. Dezember 2018, 18-20 c.t.
Cindy Wittke. Zwischen Konflikt und Kooperation: Politiken des Völkerrechts im postsowjetischen Raum

Seit 1991 stehen die Nachfolgestaaten der Sowjetunion vor der Herausforderung, ihre eigenen Politiken des Völkerrechts zu formulieren und umzusetzen. Konfliktdynamiken in der postsowjetischen Region, insbesondere der russisch-georgische Krieg, die Annexion der Krim sowie der bewaffnete Konflikt in der Ostukraine scheinen diese Staaten sowie die gesamte internationale Staatengemeinschaft mit der Umdeutung oder gar Infragestellung grundlegender Prinzipien der internationalen rechtlichen und politischen Ordnung(en) zu konfrontieren.
Dieser Vortrag untersuchte den Wissensstand über die Dynamiken der Konflikte und Kooperationen im Bereich der Politiken des Völkerrechts im post-sowjetischen Raum. Cindy Wittke befasste sich mit der Frage der relativen Unterrepräsentation von Rechts- und Politikexpert*innen aus der Region in einem internationalen Diskurs, der von westlichen Spezialist*innen dominiert wird. Ihr lebhafter Bericht bot Einblicke, wie ihr laufendes vom BMBF gesponsertes Projekt versucht diese epistemischen Ungleichgewichte anzugehen und dabei berücksichtigt, dass sich eine "multipolare" Welt bildet, in der unterschiedliche Vorstellungen von internationalem Recht und Souveränität um Legitimität konkurrieren.
Die Diskussion befasste sich auch mit aktuellen Fragen, einschließlich der unterschiedlichen Auffassungen des Völkerrechts, die Russland auf seine "Nähe zum Ausland" gründet und weiter entfernter Konflikte, wie jener in Syrien.
Dr. Cindy Wittke hat im Völkerrecht promoviert und ist Leiterin der Nachwuchsforschungsgruppe „Frozen and Unfrozen Conflicts“ am Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung (IOS), wo sie an einem neuen Buchprojekt zu „‘Test the West‘ – Contested Sovereigntiesx in the post-Soviet Space“ sowie einem neuen Projekt „Zwischen Konflikt und Kooperation – Politiken des Völkerrechts im postsowjetischen Raum“ arbeitet.

CITAS Ringvorlesung, 10. Dezember 2018, 18-20 c.t.
Thorsten Kingreen: Supranationaler Föderalismus: Die Europäische Union zwischen Integration und Desintegration

Die Europäische Union befindet sich in einer Phase der Transformation, in der nicht nur akute Krisen bewältigt werden müssen, sondern auch ihre föderale Statik neu vermessen wird. Integration wie Desintegration haben sie auf ihrem gesamten Weg begleitet. Der Vortrag fragt, wie viel Desintegration die Union verträgt oder sogar benötigt und wo sie auf Integration, auf gemeinsame Regeln und Werte zwingend angewiesen ist.
Prof. Kingreen argumentierte in seinem Vortrag, dass die Verwendung des Begriffs "Krise" zu simpel sei, um die aktuellen supranationalen Strukturen der EU zu beschreiben, auch wenn sie durch westeuropäische Ereignisse - (Brexit- und Gelbwesten-Proteste in Frankreich) und Osteuropa unter Druck geraten (fragwürdiger Umgang mit Rechtsstaatlichkeit und Pressefreiheit in Polen und Ungarn). Stattdessen zeigte sein historischer Abriss über die Entstehung des europäischen Rechts seit der Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, wie die Beziehungen innerhalb der EU schon immer durch Spannungen der Integration und Desintegration geprägt wurden. Sein Vortrag sowie die anschließende Diskussion beschäftigte sich mit der Frage nach der Art und Weise, wie das supranationale europäische Recht mit den Spannungen um die übermäßige nationale Souveränität in der Gerichtsbarkeit umgeht und wie es verwendet werden kann, um nicht nur den internationalen Handel, sondern auch gemeinsame Werte zu fördern.
Prof. Dr. Thorsten Kingreen leitet den Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Sozialrecht und Gesundheitsrecht der Fakultät für Rechtswissenschaften an der Universität Regensburg. In seiner Forschung beschäftigt er sich u.a. mit dem Europäischen Gemeinschaftsrecht, Sozial-, Gesundheits- und Medizinrecht.

CITAS Ringvorlesung, 17. Dezember 2018, 18-20 c.t., H4
Jochen Mecke: Nationale Identität und Welt-Literatur

Kaum ein Medium hat bei der Ausbildung nationaler Identität eine so zentrale Rolle gespielt wie die Literatur. Dies gilt vor allem für die deutsche Kulturgeschichte. Und doch war es ausgerechnet einer der wichtigsten Protagonist*innen der deutschen Klassik, Johann Wolfgang Goethe, der die Idee der Weltliteratur ins Leben rief. Wie hängen diese beiden scheinbar gegensätzlichen Ideen der National- und der Weltliteratur miteinander zusammen? Und was heißt Weltliteratur heute? Gehören internationale Beststeller wie Harry Potter zur Weltliteratur? Oder sind damit nicht vielmehr die Klassiker eines weltweit geltenden Literaturkanons gemeint? Welche Funktion hat Weltliteratur? Ist sie nicht in beiden Fällen Ausdruck einer kulturellen Globalisierung und Homogenisierung, die sich auf Kosten kultureller Diversität vollzieht? Stellt sie nicht gerade eine Form des kulturellen Imperialismus dar, bei dem das „Jenseits der Nation“ vor allem darin besteht, Kulturnationen ins Jenseits zu befördern? Der Beitrag zeigte die Rolle und die Funktionen der Weltliteratur im gegenwärtigen Kontext auf.
Jochen Meckes spannender Vortrag bot einen Überblick über die unterschiedlichen nationalen, regionalen und historischen Auffassungen der Weltliteratur. Frühere Definitionen des Konzepts spiegelten tatsächlich die globalen Auswirkungen des Goethe-Konzepts wider und präsentierten die Weltliteratur als Bausteine, die von Zivilisationen über Jahrtausende hinweg in verschiedenen kulturellen Umgebungen produziert wurden. Während einige auf einem oft eurozentrisch definiertem Kanon basieren, der rein quantitativer und damit kommerzieller Art ist, konzentrierte sich Prof. Mecke auf eine dynamische Definition. Er argumentierte, dass die Weltliteratur ein soziales Konstrukt ist, das von den Anforderungen der Kulturen und des jeweiligen Zeitalters, in dem das Konzept angewendet wird, geformt wird. Er betonte auch die Bedeutung des Inhalts eines Werkes sowie seiner Bedeutung für die jeweilige Kultur hinsichtlich der Determination, ob ein literarisches Werk als "Weltliteratur" betrachtet werden könne. Die Überschneidung von globalen oder universellen Bestreben, insbesondere im Falle der Weltliteratur, die heute oftmals Werke impliziert die eine transnationale Komponente haben, und die Art und Weise, wie Literatur gleichzeitig Projekten bei der Ausbildung des Nationalbewusstseins dienen kann, bereicherte ganz besonders die anschließende Diskussion.
Prof. Dr. Jochen Mecke ist Kultur- und Literaturwissenschaftler für Romanischen Kulturen (Schwerpunkt Frankeich und Spanien), Leiter des Forschungszentrums Spanien und Sprecher von CITAS. Publikationen zur Literatur, zur Kultur und zum Film in Frankreich und Spanien. Laufende Projekte zur Krise in Spanien und zur Kulturgeschichte der Lüge.
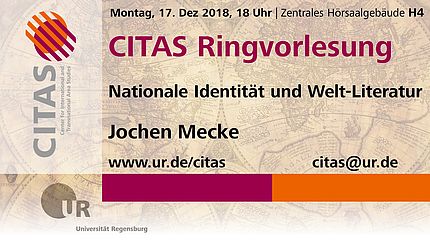
CITAS Ringvorlesung, 7. Januar 2019, 18-20 c.t., H4
Rainer Liedtke. Die europäische Integration seit dem Ersten Weltkrieg

Was 1951 als „Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl“, getragen von sechs Staaten, begann, entwickelte sich im Laufe der Jahrzehnte zu einer hochkomplexen, politischen Organisation nahezu aller europäischen Länder. In diesem Vortrag geht Prof. Dr. Rainer Liedtke der Frage nach, ob die europäische Integration als historisches Erfolgsprojekt betrachtet werden kann oder dieser Prozess mittlerweile zu einer Spaltung des Kontinents führt.
Prof. Liedtkes tiefgreifender Überblick über die europäische Integration setzte zunächst historisch im 19. Jh. an, als die ersten Konzepte einer europäischen wirtschaftlichen Integration entstanden. Anschließend skizzierte er die Entwicklung von Strukturen und Institutionen, welche die heutige EU bilden und deren Grundlagen in dem Schuman-Plan von 1950 und im Vertrag von Rom von 1956 zu finden sind. Er untersuchte auch die historischen Bedingungen in verschiedenen Etappen der EWG und der EU-Erweiterung. Hier beeinflussten langjährige historische Beziehungen die westeuropäischen Perspektiven der Osterweiterung, wie jene Frankreichs zu Rumänien oder Deutschlands zu Ostmitteleuropa, während es in den 1980er Jahren auch politische Ziele bei der Süd-Erweiterung ehemaliger Diktaturen gab. Während in den ersten 40 Jahren der institutionellen europäischen Integration nach dem zweiten Weltkrieg insbesondere nationale Regierungen und deren Interessen dominierten, wurde im Zuge der Integration der Intergouvernementalismus zugunsten der Supranationalität zurückgedrängt. Ob es eine heutzutage eine Rückkehr zum Nationalen gibt, wird sich noch zeigen.
Sein historischer Überblick zeigte, dass nicht die wirtschaftliche Integration, die nicht ohne Reibungen und Ungleichheiten oder mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten hinsichtlich einer einheitlichen Währung auskam, sondern dass es vor allem bei den europäischen Werten und der Idee von einem gemeinsamen Europa zu Abweichungen kommt. Diese Befürchtungen hinsichtlich der Zukunft Europas prägten auch die folgende Diskussion.
Prof. Dr.Rainer Liedtke hat den Lehrstuhl für Europäische Geschichte (19. und 20. Jh.) am Institut für Geschichte der UR inne. Er hat an der Universität Oxford promoviert und an der JLU Gießen habilitiert. Er hat mehrere Publikationen in unterschiedlichen Sprachen im Bereich der vergleichenden europäischen Geschichte, mit Schwerpunkt auf den britischen, jüdischen und deutschen Erfahrungen, veröffentlicht.
CITAS Ringvorlesung, 14.01.2019, 1815-1945, H4
Marek Nekula. Nationale und transnationale Erinnerungsnarrative

Der Vortrag erläuterte einführend, was Narrative bzw. Erinnerungsnarrative sind und welche Funktionen sie in nationalen und transnationalen (europäischen) Erinnerungsdiskursen bei der Definition der kollektiven Identität einnehmen. Konkretisiert wurde dies anhand der Narrative der Vertreibung/en, die Claus Leggewie in seinem Modell der konzentrischen Kreise europäischer Erinnerungskulturen in deren Zentrum – gleich hinter die Erinnerung an den Holocaust/die Shoah und den Gulag – stellt und die in Zentraleuropa etwa im Zusammenhang mit dem „Zentrum gegen Vertreibungen“ kontrovers diskutiert wurden. Am Beispiel des Wandels der Narrative der Aussiedlung/Vertreibung in der tschechischen Literatur wurde in diesem Rahmen schlaglichtartig der allmähliche Wandel von nationalen zu transnationalen Erinnerungsnarrativen nachgezeichnet.
Prof. Nekula bot einen klaren theoretischen und konzeptionellen Einblick in wichtige Konzepte der Erzählforschung, einschließlich der Erzählung selbst, des Diskurses und der Meistererzählung. Er demonstrierte, wie diese Konzepte zur Ermittlung der Dynamik von Erinnerungsnarrativen in den deutsch-tschechischen Beziehungen angewendet werden können und konzentrierte sich auf die Spannungen zwischen den Selbstwahrnehmungen und den Wahrnehmungen anderer als Opfer und / oder Täter. Diese Wahrnehmungen können in der Literatur- und Erinnerungsgeschichte unterschiedlich angewendet werden. Auch die transnationale Verbreitung der Begriffe, die von jeder Gruppe zur Beschreibung von jeweiligen Erfahrungen verwendet wurden (einschließlich der tschechischen "Odsun" und der deutschen "Vertreibung" oder "Heimat"), verweisen darauf, inwiefern ein Wille zum Dialog vorhanden ist oder ignoriert wird. Letzlich sei die tschechische Literatur von einem Fokus auf die Tschechen als Opfer zu einem Modell übergegangen, in dem die Deutschen als Opfer tschechischer Aktionen anerkannt werden. Während öffentliche politische Diskurse zum Gedächtnis weniger dialogisch sind und an nationale Erzählungen gebunden bleiben, zeichnen sich transnationale Erinnerungsnarrative durch das Aufbrechen von nationalen Kategorien und die Fokussierung auf die Opfer aus.
Prof. Dr. Marek Nekula ist Professor für Bohemistik und Westslavistik, Mitglied der Graduiertenschule für Ost- und Südosteuropastudien und Leiter des Bohemicum. In seiner Forschung beschäftigt er sich mit Literatur, Sprachvergleich und -kontakt, Kultur und Erinnerungskulturen des tschechischen/slawischen und deutschen Raums.
CITAS Ringvorlesung, 21. Januar 2019, 18-20 c.t.
Birgit Bauridl. Erinnerung als transnationales Event: Deutsch-amerikanische Verhandlungsräume in Bayern nach 1945
Im April 1945 bombardierten US Streitkräfte das Wehrmachts-Trainingsgebiet um Grafenwöhr in der Oberpfalz; zwei Wochen später befreiten sie das nahe gelegene Konzentrationslager Flossenbürg. Damit begann eine komplizierte Verflechtungsgeschichte deutsch-amerikanischer Präsenzen, Begegnungen und Erinnerung en im ländlichen Raum der Oberpfalz. Dieser Vortrag diskutiert diverse Verhandlungsräume und performative Inszenierungen dieser transnationalen Erinnerung—von der Gedenkstätte in Flossenbürg über das 9/11 Memorial in Oberviechtach bis zum deutsch-amerikanischen Volksfest in Grafenwöhr.
Der Vortrag beleuchtete insbesondere die Rolle der Region als Player zwischen nationalen und transnationalen Kräften am Beispiel von Erinnerungsmanifestationen jenseits des Archivs - als Event und Verhaltensform. Dr. Bauridls spannender Vortrag untersuchte die vielfältigen Skalen transnationaler Beziehungen, wobei auch einzelne Erinnerungsorte oder kultureller Austausch innerhalb von Dorfgemeinschaften über transnationale und globale Dimensionen verfügen. Bauridl zeigte auch, wie Alltagserfahrungen in der Gegenwart von scheinbar peripherer Dimensionen, wie die Bildung von Identitäten, von grenzüberschreitenden, transnationalen Dimensionen geprägt werden. Hinsichtlich der Erinnerungsforschung hat Dr. Bauridl gezeigt, dass nicht nur das Archivmaterial der Vergangenheit Erinnerungs- und Identitätsstiftend wirkt, sondern auch performative Aspekte der Begegnung impliziert sind.
Ihr Vortrag veranschaulichte den Wandel zu einer "transnationalen Amerikanistik", die nicht nur das amerikanische Leben, Kultur und Gesellschaft innerhalb der nationalen Grenzen untersucht, sondern auch die globalen Auswirkungen der Politik, Kultur und Bürger der USA.
Dr. Birgit Bauridl ist Akademische Rätin in der Amerikanistik der UR und Co-Director des Regensburg European American Forums (REAF). Ihre Forschung beschäftigt sich mit transnationaler Theorie, Kritischem Regionalismus, cultural performance, deutsch-amerikanischer Erinnerungskultur nach 1945. Publiziert hat sie u.a. die Bände: "Betwixt, Between, or Beyond: Negotiating Transformations from the Liminal Sphere of Contemporary Black Performance Poetry" (2013); "South Africa and the United States in Transnational American Studies" (co-ed. U. Hebel; AmSt 2014); "Approaching Transnational America in Performance" (co-ed. P. Wiegmink, 2016); "German-American Encounters in Bavaria and Beyond" (co-ed. I. Gessner, U. Heble, 2018). Zusammen mit Dr. Pia Wiegmink leitet sie das internationale DFG-Netzwerk „Cultural Performance in Transnational American Studies“ (2014-2018).
Letzter Vortrag der CITAS Ringvorlesung, 28. Januar 2019, 18-20 c.t.
Edgar Schneider. Areal Varities of English: From local to global

Dieser Vortrag hat in englischer Sprache stattgefunden.
Sprachvariation ist ein spezifisch räumliches Phänomen – unser Sprechen verrät, wo wir herkommen und wer wir sind. Die Verbindung zwischen Sprachformen, Raum und Identität wirkt auf mehreren Ebenen - der lokalen, regionalen, nationalen, supranationalen und globalen. Bei dem Vortrag wurden Beispiele untersucht, die all diese Dimensionen im englischsprachigen Raum veranschaulichten, wobei Prof. Schneider Audio- und Videoclips sowie Erkenntnisse aus mehreren Konzepten heranzog. Abschließend wurden Versuche betrachtet, welche die flächenbezogene (oder räumliche) Variabilität der Sprache theoretisch unterscuhten. Dabei wurden insbesondere Debatten untersucht, die sich mit der Definition von räumlichen Schwankungen beschäftigten, worum es sich bei "World Englishes" und was die Begriffe "Plurizentrizität" und "Pluri-Areality" bedeuten.
Prof. Schneider stützte sich auf Beispiele aus der ganzen Welt und konnte aufzeigen, wie sich der Einfluss der Politik, der Wirtschaft und der Alltagspraxis auf die Art und Weise auswirken, in der sich mehrere Englischvarianten gebildet haben. Er wies auf die Bedeutung der Linguistik für die Area Studies und umgekehrt hin. In beiden Fachbereichen operieren die Felder mit räumlichen Kategorien und zeigen Zusammenhänge von Politik und Praxis auf. In seinem Vortrag ging es um die Art und Weise, wie mehrere Skalen in der Sprachbildung und -nutzung sichtbar werden; diese reichen von lokal über national und supranational bis hin zu global (Nationen des Verbands Südostasiatischer Nationen, "ASEAN-countries", benutzen Englisch als ihre Arbeitssprache. Ein faszinierendes supranationales Beispiel) Prof. Schneider zeigte aber auch die Bedeutung nichtkontingenter Verbindungen, die dennoch transnationale und globale Aspkte haben, z. B. durch Migration oder Isolation von Sprechern. Außerdem demonstrierte er die vielfältigen Methoden, die in der Sprachforschung angewendet werden; von der Untersuchung Archivmaterials über Interviews bis hin zu neuen Möglichkeiten der wissenschaftlichen Mikromessung von Sprache.
Prof. Dr. Edgar Schneider ist Lehrstuhlinhaber für Englische Linguistik am Institut für Anglistik und Amerikanistik. Seine Forschung konzentriert sich auf weltweite Variationen des Englischen, darunter auf Variationen des amerikanischen Englisch, Pidgin und der Kreolischen Sprachen. Er hat zahlreiche Publikationen veröffentlicht, darunter eine Monographie bei Cambridge University Press mit dem Titel „English Around the World: An introduction“ (2011) und das in Kürze erscheinende „The Cambridge Handbook of World Englishes“, das unter Zusammenarbeit mit Marianne Hundt und Daniel Schreier herausgegeben wurde. An der Universität Regensburg leitet er das Research Center for World Englishes.




















