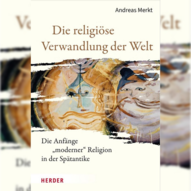Die Wanderausstellung „Körperwelten“ des Anatomen von Hagen hat in jüngster Zeit neu die Frage aufgeworfen, wie man mit dem Körper verstorbener Menschen umgehen solle, ob er gezeigt oder gar zur Schau gestellt werden dürfe und wenn ja, in welcher Weise.
Die Kontroverse ist alt. Im vierten Jahrhundert musste sich Bischof Athanasius von Alexandria mit einem bizarren Brauch auseinandersetzen. Einige Ägypter, darunter auch Christen, pflegten die Mumien ihrer verstorbenen Angehörigen in ihren Häusern aufzubewahren. Athanasius lehnte dies ab und forderte eine ordentliche Bestattung der Leichname. Auch andere antike Theologen urteilten auf dieser Linie. Damit entsprachen sie der allgemeinen Meinung ihrer Zeit: Es galt weithin in der antiken Mittelmeerwelt als heilige Pflicht, die Toten zu bestatten. Nur für die kurze Zeit der Riten des Übergangs, die mit der Beisetzung abgeschlossen wurden, war der Leichnam noch sichtbar und berührbar. Dauerhafte Präsentationen von Leichen und Leichenteilen dienten hingegen in der Regel der Schändung der Toten oder zur Abschreckung der Lebenden.
Während also in der Antike die positiv konnotierte materielle Präsenz der Toten, wie sie in Ägypten begegnet, noch einen Sonderbrauch darstellte, sind die mittelalterliche und die byzantinische Welt durch die Allgegenwart von Körperreliquien geprägt. Offenbar hat hier ein Wandel in der Bewertung der Sichtbarkeit und Berührbarkeit toter Körper und Körperteile stattgefunden.
Wo lassen sich außerhalb Ägyptens in der christlichen Literatur und Kunst Darstellungen und Ausstellungen von Körperreliquien erstmals nachweisen? Wie kam es zu diesem Wandel in der Einstellung zum toten Körper? Das Projekt „Leichen – Skelette – Reliquien“ begibt sich auf eine Spurensuche.
Dabei werden speziell die (griechischsprachigen christlichen) „Popularmedien“ der Spätantike in den Blick genommen: die Apokryphen, hagiographische Literatur, Predigten, Grabinschriften und bildliche Darstellungen. Es soll untersucht werden, in welcher Weise hier der tote Körper Erwähnung findet. Es geht dabei um den toten Körper nicht nur in seiner realen Präsenz, sondern auch in seiner symbolischen Repräsentanz, da anzunehmen ist, dass eine Wechselwirkung besteht zwischen dem Umgang mit dem realen toten Körper einerseits und dem Gebrauch entsprechender Symbole und Metaphern andererseits.
Das Projekt verspricht auch Aufschlüsse über weitergehende Fragen zu geben: Welchen Einfluss übte das christliche Ägypten in der Spätantike auf Frömmigkeit und Mentalität der übrigen Regionen der Mittelmeerwelt aus? Welche Unterschiede zeigen sich in den einzelnen Regionen der östlichen Mittelmeerwelt? Wie verhalten sich theologische Theorie und religiöse Praxis zueinander? Besteht ein Zusammenhang zwischen der „Niederlage des (lebenden) Körpers“, wie sie Jacques LeGoff konstatiert hat, und dem Siegeszug des toten Körpers in Spätantike und Frühmittelalter?
Das Projekt steht im Kontext des übergreifenden Vorhabens „Metamorphosen des Todes“, das in Regensburg unter anderem in mehreren DFG-Projekten bearbeitet wird und dessen Zwischenergebnisse sich in mehreren Monographien nachlesen lässt, zuletzt J. Dresken-Weiland, Bild, Grab und Wort, 2010 und dies./A. Angerstorfer/A. Merkt, Schalom, Himmel, Paradies, 2011.
Dresken-Weiland, Jutta, Bild, Grab und Wort. Untersuchungen zu Jenseitsvorstellungen von Christen des 3. und 4. Jahrhunderts, Regensburg: Schnell & Steiner 2010.
Bilder an und in christlichen Gräbern waren häufig nur für einen bestimmten Personenkreis sichtbar:
Ausgemalte Grabkammern verschloss eine Tür und marmorne Särge wurden oft in der Erde untergebracht, um sie vor Plünderung zu schützen. Die Frage, welche Bildthemen Christen bevorzugten und welche Vorstellungen sie damit verbanden, wird in diesem Band erstmals systematisch gestellt.
Warum erscheint Petrus so häufig auf Sarkophagen und warum wird er so selten in den Katakomben dargestellt? Welche Bedeutung haben Mahldarstellungen? Wie drückt sich die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod und die Auferstehung von den Toten in den Bildern aus? Anhand zahlreicher Abbildungen und schriftlicher Quellen werden wichtige neue Forschungsergebnisse über das Werden der frühchristlichen Kunst und über die unterschiedliche soziale Struktur ihrer Auftraggeber vorgestellt.
Was dachten Christen beim Betrachten von Bildern im Grabbereich, warum suchten sie welche Bilder für ihre Gräber aus und welche Bilder waren ihnen besonders wichtig? Das Buch fragt nach den häufigsten Bildthemen des 3. und 4. Jahrhunderts, nach einem Zusammenhang zwischen ihnen und theologischen Kommentaren sowie nach dem sozialen Hintergrund der christlichen Auftraggeber.
(Text: Webseite des Verlags Schnell & Steiner)
Dresken-Weiland, Jutta/Angerstorfer, Andreas/Merkt, Andreas, Himmel - Paradies - Schalom. Tod und Jenseits in christlichen und jüdischen Grabinschriften der Antike, Regensburg: Schnell & Steiner 2012.
Das vorliegende Buch präsentiert griechische, hebräische und lateinische Grabinschriften mit deutscher Übersetzung und wissenschaftlichem Kommentar, der den jeweiligen Text in seinen antiken Zusammenhang einordnet und seine Besonderheiten erklärt. Wenn möglich, ist eine Abbildung des Inschriftträgers beigegeben. Es sind unterschiedliche Menschen aus verschiedenen sozialen Schichten und Jahrhunderten, die angesichts des Todes sprechen und viele Facetten von Jenseitshoffnung zum Ausdruck bringen. Die christlichen Texte zeigen durchgehend ein freundliches und friedvolles Jenseits, in dem die Toten Gemeinschaft mit Gott haben. Die jüdischen Inschriften betonen die Sicherstellung der ungestörten Grabesruhe mit dem Wunsch »Schalom« bzw. »in Frieden sei sein/ihr Schlaf«. Jenseitshoffnung drücken die Inschriften in den Katakomben von Beth She’arim in Israel häufiger aus als die Texte aus Italien, entsprechend der rabbinischen Diskussion, ob es eine Auferstehung der Toten in der Diaspora gibt.
Wie formulierten Christen und Juden ihre Vorstellungen über Tod und Jenseits? Wie drücken sie ihre Hoffnungen aus und wie stellen sie sich das Bei-Gott-Sein vor? Diese Sammlung von christlichen und jüdischen Grabinschriften zeigt uns Menschen des 3. bis 7. Jahrhunderts, die ihre Hoffnung zum Ausdruck bringen, dass mit dem Tod nicht alles aus ist, sondern ein neues Leben beginnt.
(Text: Webseite des Verlags Schnell & Steiner)
Diese Tabellen wurden in dem von der DFG geförderten Projekt „MECA – Mors secundum epigrammata christiana antiqua. Vorstellungen von Tod und Jenseits im Spiegel christlicher Grabinschriften" von Jutta Dresken-Weiland erarbeitet. Die aus diesem Projekt hervorgegangenen Veröffentlichungen sind oben genannt.
Die Jenseitsaussagen in Grabinschriften wurden je nach Region in Tabellen zusammengestellt. Formulierungen, die lediglich „in pace“ oder „dormit in pace“ bieten, sind ihrer Häufigkeit wegen nicht aufgeführt. Die Anordnung erfolgt alphabetisch nach Fund- bzw. Aufbewahrungsort, Datierungsvorschläge und kurze Bemerkungen zum Kontext werden angegeben.
Wegen der Vielfalt der Jenseitsvorstellungen und Aussagen im Umgang mit dem Tod, die sich durch Datenbank-Recherchen nicht in ihrer Komplexität abbilden lassen, möchten wir diese Tabellen hier für weitere Forschungen zur Verfügung stellen. Bitte verweisen Sie beim Zitieren auf das übergeordnete Projekt „Metamorphosen des Todes“ am Lehrstuhl bzw. nennen Sie den Link, unter dem die Tabellen eingestellt sind:
MECA Tabelle Afrika; MECA Tabelle Ägypten; MECA Tabelle Balkanhalbinsel; MECA Tabelle Gallien; MECA Tabelle Italien; MECA Tabelle Rom; MECA Tabelle Spanien