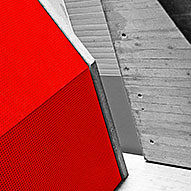Vom Ethos des Teilens
Where to, Open Science? Leibniz-WissenschaftsCampus und Graduiertenschule Ost- und Südosteuropastudien (UR) luden zur Diskussion
1. Februar 2023
Stellen Sie sich vor, Sie gehen in ein Restaurant, bringen die Zutaten für Ihr Essen mit, kochen selbst und zahlen dann nicht wenig dafür, dass man Ihnen dieses Essen auf einem Teller serviert. Absurd? So funktioniere wissenschaftliches Publizieren heute weltweit, sagt Tony Ross-Hellauer, PhD, der an der Universität Graz zu Wissenschaftspolitik und Open Science forscht. Die Veröffentlichung von Forschungsergebnissen in renommierten Journalen ist aufwendig, kostspielig und für akademische Karrieren auch 2023 nicht unerheblich. Warum veröffentlichen Wissenschaftler*innen nicht einfach direkt im Internet? Warum machen sie Forschungsergebnisse, Daten, Methoden nicht kostenfrei zugänglich?
Von Open Science würden alle profitieren, davon sind Ross-Hellauer, Informationswissenschaftler mit Abschlüssen in Philosophie und Bibliothekswissenschaften und Professor Dr. Björn Brembs, Neurobiologe an der Universität Regensburg, fest überzeugt. Auf Einladung der Graduiertenschule Ost- und Südosteuropa (UR) und des Leibniz-WissenschaftsCampus „Europe and America in the Modern World“ diskutierten die beiden Wissenschaftler das Thema unlängst mit Lehrenden und Forschenden aus Geistes- und Sozialwissenschaften der Universität Regensburg und des Leibniz-Instituts für Ost- und Südosteuropaforschung (IOS).
Transparency, Access, Participation – Wissenschaft soll den Kriterien der Transparenz, der Zugänglichkeit, der Teilhabe folgen: Diese Ideen liegen Open Science zugrunde. Alle sollen die Chance haben beizutragen, Forschungsdaten sollen öffentlich zugänglich sein, Methoden und darauf basierende Ergebnisse frei verteilt und reproduziert werden können. Warum?
 Dr. Tony Ross-Hellauer und Prof. Dr. Björn Brembs bei der Veranstaltung "Where To, Open Scholarship?"
Dr. Tony Ross-Hellauer und Prof. Dr. Björn Brembs bei der Veranstaltung "Where To, Open Scholarship?"
Because we can? Because we should?
„Der heutige Stand wissenschaftlicher Kommunikationswege“, sagt Ross-Hellauer, ist ein „Prozess aus dem 19. Jahrhundert, den wir an ein Kommunikationsformat aus dem 17. Jahrhundert anpassen“. Gedruckte Journale, Fachzeitschriften, die man zwischenzeitlich auch als PDF herunterladen kann: „Langsam aber sicher passen wir uns eben doch der Web-Technologie von 1995 an.“ Die Heiterkeit im Publikum weicht der Nachdenklichkeit, als Ross-Hellauer daran erinnert, dass Wissensproduktion aus öffentlichen Geldern gespeist wird und damit öffentliches Gut ist, das allen zugänglich sein sollte. Und vielleicht sei ein weiterer Grund, dass der Status quo vielleicht nicht ideal ist? Because the way we do things currently isn’t going great?
Eine Vielzahl von Praktiken fiele unter Open Science: Offener Zugang zu Publikationen, Software, Methoden und nicht zuletzt Daten – sie sollen FAIR sein, findable, accessible, interoperable, reusable. Auch die Teilhabe aller Bürger*innen an wissenschaftlichen Projekten, Citizen Science, ist ein Trend, der sich verfestigt. Ob das Zählen von Eichhörnchen oder die Zuschaltung zu NASA-Konferenzen: Wer will, kann heute an wissenschaftlichen Untersuchungen aktiv teilnehmen, sich am Sammeln von Daten beteiligen, darüber abstimmen, in welche Richtung Forschungsprojekte gehen sollen. Das gilt nicht nur für Natur- oder Lebens-, sondern auch für Geistes- und Sozialwissenschaften. Schließlich: Gutachter*innen und Autor*innen könnten bei Evaluationsverfahren oder Peer Reviews explizit voneinander Kenntnis haben.
Do you hate open science?
Das vorwiegend geisteswissenschaftliche Publikum von Ross-Hellauer und Brembs beantwortet diese Frage mit Nein, unterstützt die Momente Transparenz, Zugänglichkeit, Teilhabe; ist einig mit Referent Björn Brembs, Naturwissenschaftler, dass der Schutz von Personen, in etwa in der Medizin, der Schutz der Persönlichkeitsrechte von Patient*innen gewährleistet sein muss. Brembs, überzeugt von Open Science, stellt eine Frage in den Raum, die im Laufe der Diskussion immer wieder aufgegriffen wird: „Warum diskutieren wir 2023 immer noch ein Potenzial, das wir seit 1995 hätten nutzen können?“
Culture change? Collective action?
Es sind Privatpersonen und Unternehmen, die Plattformen hosten und betreiben, auf denen Wissenschaft „stattfindet“. Die wissenschaftliche Community hat keinerlei Plattform, die sie selbst beherrscht. Brembs weist darauf hin, dass viele Mitglieder der Scientific Community im Hinblick auf die letzten Ereignisse bei Twitter überlegen, den Dienst zu verlassen und zu Mastodon zu wechseln. Aber letzteres ist kompliziert und wenig beliebt. Zugleich komme ein erfolgreicher Wissenschaftler an persönlichen Social-Media-Accounts nicht mehr vorbei, glaubt Brembs. Warum also finden die Wissenschaftler*innen weltweit nicht zueinander und nutzen seit 15 Jahren vorhandene Technologie nicht in ihrem Sinne und letztlich dem der Allgemeinheit? Lieferten sich stattdessen sogar einzelnen Exzentrikern aus? „We have a collective action problem“, sagt Brembs.
Verschiedene weitere Erklärungsansätze tauchen auf – einer davon ist, dass manche den Prinzipien offener Vorhaben einfach skeptisch gegenüberstehen. Technische Unkenntnis wird ins Feld geführt, aber auch der Unwillen, Erkenntnisse zu teilen; schließlich die Angst davor oder das Wissen darum, dass man viel Zeit investieren müsse, um das zugänglich Gemachte auch verständlich darzustellen.
Professor Dr. Ulf Brunnbauer, wissenschaftlicher Direktor des Leibniz-WissenschaftsCampus und des IOS, erinnert an die jüngsten Ausführungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft und an die UNESCO-Empfehlung zu Open Science, die Momente Inklusion und Sprachenvielfalt. Mühsame Archiv-Arbeit ganzer Forscher*innen-Generationen ließen sich durchaus würdigen. Bei Forschungsprojekten ermittelte Meta-Daten ließen sich auch in den Geisteswissenschaften in vielen Fällen nützlich verwenden, würden sie geteilt. Dass nicht alles für alle öffentlich gemacht werden könne, sagt Brunnbauer, sei klar: „But what we need to establish is an ethos of sharing.“ Ross-Hellauer empfiehlt strategisch vorzugehen, mehr Beispiele an die Hand zu geben, was möglich ist, Anreize zu schaffen und so den aus seiner Sicht unabdingbaren Kulturwandel herbeizuführen.
twa.
Informationen/Kontakt
Zu den Referenten der Veranstaltung
Positionierung der Deutschen Forschungsgemeinschaft zu Open Science
UNESCO zu Open Science