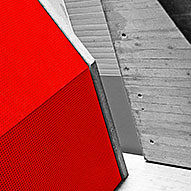Die Komplexität der Zukunft
Prof. Dr. Harald Lesch über Grundlagenforschung für Nachhaltigkeit – Öffentlicher Vortrag bei der DPG-Tagung an der UR
8. September 2022
Vorträge schaffen es selten, das Audimax der Universität Regensburg an die Grenzen seines Fassungsvermögens von 1475 Plätzen zu bringen. Einer aber schafft’s mühelos und der Referent holt sich auch noch über 400 Interessierte online dazu: Professor Dr. Harald Lesch, Physiker, einer breiten Öffentlichkeit aus „Leschs Kosmos“ oder „Terra X“ bekannt. Er sprach am Abend des 6. September 2022 in einem öffentlichen Vortrag zum Thema „Grundlagenforschung für Nachhaltigkeit“ an der Universität Regensburg bei der Jahrestagung der Sektion Kondensierte Materie der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (DPG). Dr. Ulrich Bleyer, DPG-Vorstandsmitglied Öffentlichkeitsarbeit, begrüßte seinen Kollegen zu einem „gigantischen Physik-Fest“ im von der UNESCO initiierten Internationalen Jahr der Grundlagenforschung für nachhaltige Entwicklung.
„Achtung!“ warnt Lesch das mehrheitlich junge Publikum zu Beginn, „dies ist ein konspirativer Abend, Sie hören einem Wissenschaftler zu“. Die fachliche Tiefe und inhaltliche Komplexität seines Vortrags beweisen dies zweifellos, doch lässt er sein Publikum das auch vergessen, denn alles „kommt irgendwie so leicht daher“, sagt ein begeisterter Student nach der Veranstaltung. Dass es „so leicht daherkommt“, ist zweifelsfrei harte Arbeit, hinzu kommen Talent und Humor. Leschs einstündiger Auftritt ist souverän, rhetorisch raffiniert, witzig. „Harald Lesch ist ein deutscher Astrophysiker, Naturphilosoph, Wissenschaftsjournalist, Fernsehmoderator und Hörbuchsprecher“, steht in seinem Wikipedia-Eintrag. Was fehlt: Harald Lesch ist Schauspieler. Ein Tausendsassa mit gewaltiger Bühnenpräsenz. Er fordert die Vorstellungskraft des Zuschauers, der Zuschauerin, heraus, wie gutes Schauspiel es tun soll. Dabei bleibt er Minimalist, braucht keine Kulissen, kein Kostüm, keine Effekte. In den ersten Minuten erinnert er mittels eines Witzes daran, dass beim Thema Nachhaltigkeit alle ruckzuck zu „Spiegelguckern“ würden – man sehe nur sich selbst.

Professor Dr. Harald Lesch am 7. September 2022 an der Universität Regensburg. Foto: Julia Dragan/UR
Zwischen Globus und Planet
Lesch tritt auf, das Audimax wird zum Sternentheater. In fünf Minuten schafft Harald Lesch eine szenische Anordnung auf der weitgehend leeren Bühne, deren Requisiten sich bis zu diesem Zeitpunkt auf einen Eimer, eine Tafel, das tagungsübliche unverständliche Blumengesteck und ein Rednerpult beschränken. „Zu meiner Linken – das ist der Globus. Die Erde, wie wir sie benutzen, wie wir sie in Ketten legen, in Netze, in Pipelines. Der Globus, das ist der Planet, den wir ausnehmen, aus dem wir herausholen, was wir können, seit vielen Jahrhunderten.“ Dann rückt Lesch die andere Bühnenseite ins Blickfeld: „Hier rechts sehen Sie den Planeten, den wir auf diesem Weg verändern.“ Fortan begleiten Globus Erde und Planet Erde den Redner, den stellvertretenden Menschen, der sich zwischen beiden bewegt und der sich vor allem eins wünscht: Wohlbefinden und Gesundheit.
Lesch eröffnet eindringlich: Beim Globus geht es um Nachhaltigkeit und Nutzbarkeit, „aber wir nutzen ihn aus“. Beim Planeten geht es um viel Fundamentaleres: Bewohnbarkeit. Es ist ein leidenschaftlicher Appell, der folgt: „Es geht um alles! Es geht um die Fähigkeit des Lebens auf einem Planeten, sich tatsächlich zu erhalten!“ Der Globus, sagt Lesch, nur einige Hundert Jahre alt, kenne Begriffe wie „Rendite“ und den Homo sapiens, „der offenbar in der Lage ist, dramatische Veränderungen vorzunehmen, die bis ins planetare System hineinreichen“. Der Planet gegenüber ist ein Produkt der kosmischen Entwicklung, des Sonnensystems, entstanden, weil ein Stern explodierte: „Und alle seine Elemente, alles, was hier sitzt, alles worauf Sie sitzen, und das, was da spricht – all diese Elemente stammen von diesem Stern“. Das ist 4,567 Milliarden Jahre her. „Woher wissen wir das?“ Lesch umkreist fast genüsslich den Planeten, bevor er die Frage beantwortet: „Von Steinen, von Meteoriten, von den genauen Grundlagenanalysen der Zusammensetzung dieser Elemente, ihrer Isotope. Wir können die Geschichte unseres Planeten erzählen, weil wir schon enorm lange Grundlagenforschung betreiben, und das nicht nur im Labor! Wir können damit kosmische Geschichte rekonstruieren.“
Physik – dessen ist Lesch sicher – ist längst zu einer historischen Wissenschaft geworden. Nicht überall, aber in der Astronomie, der Geophysik und der Biologie – „drei wichtige Wissenschaften, die uns erklären, woher wir kommen.“ Lesch berichtet vom Beginn des Planeten, den Steinen und Kristallen, die uns sein Alter verraten, von der durch Grundlagenforschung möglich gewordenen Rekonstruktion der Bedingungen, unter denen auf diesem Planeten Leben entstanden ist. Aus all dem resultiert „das Weltbild, aus dem wir seit 400 Jahren den Globus geschaffen haben“: Im Jahr 1572 habe ein dänischer Forscher einen neuen Stern am Himmel beobachtet und Ungeheuerliches passieren lassen. Nun gelang es, zu berechnen, wie die Planeten sich bewegten oder wann es zur nächsten Sonnen- und Mondfinsternis käme. „Es gelang sogar, die Bahn von Kometen zu prognostizieren und zu sagen - der ist in 76 Jahren wieder da. Die Himmelsmechanik holte den Himmel auf die Erde, auf den Schreibtisch, ins Labor.“ Aus diesen Berechnungen ergaben sich Prognosen, aus diesen Vorhersagen. „Und aus den Vorhersagen ergab sich ein Weltbild, in dem Natur berechenbar ist.“
Ein Jurassic-Park-Experiment
Was folgte, war die Vermutung, dass in den Naturgesetzen „eine Funktion steckt, die ich nutzen kann.“ Nun wurde Grundlagenforschung gemacht, um direkt umgesetzt zu werden, etwa in Maschinen, die besondere Eigenschaften besitzen. Neu waren die Erkenntnisse zu periodisch wiederkehrenden Rhythmen – die immer wieder aufgehende Sonne, die Rückkehr der Jahreszeiten. „Nun lebt der Mensch aus dem Vertrauen heraus, dass er die Natur immer besser kennt und immer besser kontrolliert“, sagt Lesch. Doch – „dann lief etwas schief“. Forschung wurde immer abstrakter, immer theoretischer, sie hatte in ihren Auswirkungen auf den Planeten immer drastischere Folgen. „Heute sind wir technologisch am Rande der erkennbaren Wirklichkeit angekommen. Wir nutzen Lichtgeschwindigkeit! Unser Alltag ist bestimmt von digitaler Technik, von Unmengen von Informationen, die um den Globus herumjagen.“ Ein Globus, den Liefer- und Wertschöpfungsketten dominieren, um den Finanzströme rasen, den die Gier beherrscht, „den wir behandeln, als würde er uns gehören“.
Lesch wendet sich nun dem Planeten zu, den all das beeinflusst: „Wir haben die Atmosphäre mit Gasen angefüllt, so dass die mittlere Temperatur auf dem Planeten steigt und steigt, was dazu führt, dass es immer weniger Eis gibt. Daraus kann man mal durchdeklinieren, was demnächst passiert.“ Weißes Eis verschwindet, wenn es zu warm wird, daraus wird in der Arktis dunkles Wasser. Tausende Quadratkilometer weißer reflektierender Fläche werden dunkel. „Die Sonne strahlt und hämmert ihre Energie immer weiter drauf. Die dunklen Flächen absorbieren die Energie, es wird wärmer, noch mehr schmilzt, es entstehen Rückkopplungsprozesse.“ Die erste Form von Nicht-Linearität, sagt Lesch, einen Kreide-Kreis an die Tafel zeichnend: „Wir haben eine Ursache, wir haben eine Wirkung. Und die Ursache wirkt auf die Wirkung zurück. Wir haben es zunehmend mit Instabilitäten zu tun.“
Diese könnten dazu führen, dass es den Planeten „zerreißt“. Entladeprozesse in der Atmosphäre, die zu Wetterexzessen führen, können sich alle ja schon anschauen, sagt Lesch: Starkwetterexzesse, auch in Deutschland, weltweit austrocknende Flüsse. Campingstühle im Yangtse? „Heute ist ein Tag, der uns klar machen sollte, dass Kernenergie keine langfristige Option für die Versorgung eines Landes ist.“ Denn wenn die Flüsse versiegen, wenn das Wasser nur zu warm ist, fehlen Kühlungsmöglichkeiten für Kernkraftwerke: „Wir sollten aufhören, in die Kreisläufe der Erde einzugreifen und besser den Fusionsreaktor verwenden, der in 150 Millionen Kilometern Entfernung von uns Wasserstoff zu Helium verschmilzt. Wunderbar macht sie das! Wirklich grandios!“ Die Menschheit, sagt Lesch, solle sich doch zumindest in den reichen Ländern, dazu aufmachen, die Sonne zu nutzen, statt für Energiegewinnung fossile Ressourcen aus dem Planeten herauszureißen und damit planetare Kreisläufe massiv zu stören. Die Betroffenheit im Publikum wird spürbar, als Lesch vor dem „Jurassic-Park-Experiment“ warnt, 300 Millionen Jahre alte Kohlenstoffe aus dem Boden zu knacken.

Foto: Julia Dragan/UR
Die Komplexität der Systeme
„Der Globus schreit – behandle mich nachhaltig, damit der Wirtschaftskreislauf immer so weitergeht…“, ruft Lesch. Und wolle man nicht nur nachhaltig sein, sondern sogar (!) dafür sorgen wollen, dass der Planet bewohnbar bleibt, „dann müssen wir diesen Planeten in seiner Systemhaftigkeit betrachten.“ Nun wendet sich Lesch direkt an die Grundlagenforschung: Sie möge sich Netze und Bedingungen anschauen, die ebenfalls komplex sind, sie möge Prozesse in den Mittelpunkt rücken, sie möge doch interdisziplinärer werden, sich „viel mehr der verschiedenen Methoden der verschiedenen Naturwissenschaften bedienen, um überhaupt die Systeme, die auf dem Planeten existieren, verstehen zu können.“
„Wir wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält“, sagt der Physiker. „Aber das Darüberhinaus, was sie bewegt, was sie werden lässt, wie sie es schafft, immer wieder neue Eigenschaften in Form von neuen Lebewesen zu kreieren, oder neue Ökosysteme zu kreieren, das ist die entscheidende Frage.“ Eine Mahnung in die eigenen wissenschaftlichen Reihen gibt es dann auch: „Kleinste Veränderungen in Ursachen führen zu gänzlich anderen Wirkungen! Die Welt der Himmelsmechanik ist die Welt, in der du Mittwoch weißt, wer dich am Sonntag besucht. Aber die wirkliche Welt ist ganz anders! Je mehr Prozessketten am Werk sind, je mehr Einflussparameter sich gegenseitig unterstützen, umso komplexer wird das System, umso stärker wird es abhängig von leichten Schwankungen der Bedingungen.“ Die Komplexität der Gegenwart werde nur noch übertroffen von der Komplexität der Zukunft. Ins intensive Schweigen des Publikums klingelt ein Handy. „Gehen Sie ruhig ran,“ sagt Lesch mit einem Anflug imaginärer Resignation, „vielleicht ist es Stockholm.“
Grundlagenforschung: existentielle Not
Künftige Grundlagenforschung müsse sich ob der zunehmenden Komplexität in Anthroposphäre und Natursphäre um Prozesse kümmern. Nicht der Planet allein, auch die Menschen seien in Gefahr. „Wir brauchen auch als Menschen eine bestimmte Außentemperatur.“ Klimaanlagen seien ein Energieproblem, sorgten aber auch dafür, dass die Menschen ihre Innentemperatur gegenüber der Außentemperatur nicht mehr regulieren können. Und dann? „Vorbei!“ Grundlagenforschung, wiederholt Lesch mehrfach, werde zu einer existentiellen Not: „Wir müssen wissen, wie Natur funktioniert, damit wir sie nicht kaputt machen. Wir müssen Systemeigenschaften verstehen, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt. Das hat was mit den Zeitskalen zu tun, auf denen wir Forschung betreiben. Der unmittelbare Gewinn, der unmittelbare Nutzen von Forschung, der gefordert wird, der ergibt sich unter Umständen erst viel später. Aber dadurch, dass wir Wissen und Forschungsgewinn haben, können wir viel schneller reagieren. Wir sind in einer Transformationssituation.“
Zwischendurch hält Lesch ein Schwätzchen mit der Thermodynamik. Ärgert sich über den Wahn, dass alles sich sofort rentieren müsse. Plädiert für einen Parlamentsausschuss für Grundlagenforschung. Sinniert über den sozioökonomischen Mainstream, der nun am Ende des „business as usual“ stehe und sich überlege, ob die grünen Spinner mit den Photovoltaik-Anlagen vielleicht doch alternative Lebenskonzepte parat haben. Man stelle sich vor, man hätte in den 1950-er Jahren eine Entscheidung zugunsten von Windkraft anstelle von Atomkraft gefällt. Dann stünde man in Sachen erneuerbarer Energie, für Lesch der einzige Weg in die Zukunft, ganz anders da. „Wie heiß soll es denn werden?“ Selbst die pessimistischsten Szenarien waren vielleicht noch zu optimistisch. Alles sei viel schneller passiert, „als wir es uns ursprünglich gedacht haben“. Es gab lange Warnungen, aber man habe sie nicht gehört, habe den Forschenden gar vorgeworfen, sie seien feindlich gegenüber der Modernisierung.
Man müsse an die Öffentlichkeit gehen, sich in den öffentlichen Diskurs hineinbegeben, „wenn das, was wir produzieren, Wirkung haben soll“, bekräftigt Lesch am Ende seines Vortrags im Dialog mit Ulrich Bleyer. „Wir produzieren mit unseren Messungen sehr präzise Ergebnisse, und das seit sehr langer Zeit.“ Und wie hält man’s mit der Nützlichkeit? Müsse man sie nicht auch bei der Grundlagenforschung einfordern, fragt Bleyer. „Ich denke, dass sie mitgedacht werden sollte“, antwortet Lesch. „Aber nicht nur.“ Es könne sehr wohl sein, dass sich Nützlichkeit von Grundlagenforschung eben erst im Laufe der Zeit ergibt. Doch man müsse eben dieser Grundlagenforschung ihren Platz lassen, nicht pausenlos nach der Lösung für das eine oder andere Problem fragen, „das engt unseren Blick zu sehr ein.“ Und die Muss- und Soll-Einmischung der Naturwissenschaften? „Können wir uns aus moralischen Fragen raushalten, die keine physikalischen im eigentlichen sind?“, fragt Bleyer. „Natürlich sind alle, die Physik betreiben, auch Menschen im weitesten Sinne“, sagt Lesch nonchalant. „Die Verantwortung, die in unserer Handlungsfreiheit steckt, wird dadurch, dass wir etwas genauer wissen, noch verstärkt.“
twa.
Informationen/Kontakt
Prof. Dr. Harald Lesch ist seit 1995 Professor für Astrophysik am Lehrstuhl für Astronomie und Astrophysik – Beobachtende und Experimentelle Astronomie an bzw. bei der Universitätssternwarte der Ludwig-Maximilians-Universität München. Zudem unterrichtet er Naturphilosophie an der Hochschule für Philosophie München. Seine Hauptforschungsgebiete sind kosmische Plasmaphysik, Schwarze Löcher und Neutronensterne. Er ist Fachgutachter für Astrophysik der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und Mitglied der Astronomischen Gesellschaft. Als Wissenschaftsjournalist und Fernsehmoderator kennt man ihn aus Sendungen wie „Leschs Kosmos“ Wer Harald Lesch live erleben möchte, hat demnächst dazu in Regensburg die Möglichkeit bei den Highlights der Physik
Zu Dr. Ulrich Bleyer
Zur aktuell auf dem Campus der UR stattfindenden DPG-Tagung