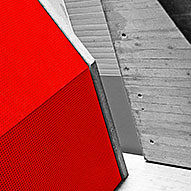#teachthevirus - die Lehre(n) aus der Pandemie
Ein Interview zum COVID-19-Seminar von Dr. Christian Reiß an der Professur für Wissenschaftsgeschichte
22. April 2020
In dieser Woche startet an der Universität Regensburg – wie an allen anderen Hochschulen auch – die Vorlesungszeit im Sommersemester 2020. Die Folgeerscheinungen der Corona-Pandemie wirken sich auch auf den Lehrbetrieb aus: Seminare und Vorlesungen finden derzeit ausschließlich digital statt, die Literaturversorgung gestaltet sich durch die Schließung der Bibliotheken schwierig. Mittlerweile findet das Virus und die Pandemie auch inhaltlich Eingang in die Lehre – ein Beispiel an der UR ist das Seminar „COVID-19: Eine Wissenschafts- und Medizingeschichte, ca. 1800-2021“, das Dr. Christian Reiß von der Professur für Wissenschaftsgeschichte (Leitung: Prof. Dr. Omar Nasim) im Sommersemester anbietet. Wir haben mit Dr. Reiß über die geplanten Inhalte des Seminars und die Herausforderungen für die Lehre in diesem besonderen Sommersemester gesprochen.
Wie kamen Sie auf die Idee zum Seminar zu COVID-19?
Dr. Christian Reiß: Wir versuchen, in unseren Veranstaltungen immer Bezüge zu aktuellen Ereignissen herzustellen. Die Notwendigkeit war noch nie so offensichtlich wie in der derzeitigen Pandemie. In den sozialen Medien konnte ich verfolgen, wie Kolleg*innen vor allem in den USA auf den Ausbruch der Pandemie reagiert haben. Sie wurde ja direkt zum Start des spring term von den Ereignissen überrascht. Und viele haben sofort angefangen, das Thema in ihre bereits fertig geplanten Kurse einzubauen. Mit dem hashtag #teachthevirus hat die amerikanische Biologin und Genderforscherin Anne Fausto-Sterling dieser breiten Bewegung ein Motto gegeben, dem auch im mich anschließe.
Der Titel des Seminars lautet „COVID-19: Eine Wissenschafts- und Medizingeschichte, ca. 1800-2021“ – wie kommt es zu diesem Zeitraum, der ja zum einen weit zurückreicht, zum anderen auch in die Zukunft blickt?
Der Zeitraum soll genau das verdeutlichen. Wir haben es mit einem historischen Ereignis zu tun, dass sich vor unseren Augen ereignet und weiter ereignen wird. Als Wissenschaftshistoriker suche ich natürlich nach den historischen Bezügen, auch um zu verstehen, was im Moment passiert und wohin das alles führen könnte.
Das heißt, es wird nicht nur um Wissenschaftsgeschichte gehen, sondern der Blick richtet sich auch bewusst in die Gegenwart und Zukunft?
Genau. Die Wissenschaftsgeschichte versteht sich heute als Teil der Wissenschaftsforschung. Gemeinsam mit Feldern wie den Science &Technology Studies (STS) erforschen wir das Phänomen Wissenschaften aus verschiedenen Blickwinkeln. Dabei hat die Wissenschaftsgeschichte wie jede andere historische Disziplin natürlich auch das Anliegen, durch die historische Perspektive einen anderen Blick auf Gegenwart und Zukunft zu ermöglichen. Auch wenn man mit historischen Vergleichen und Schlüssen vorsichtig sein muss, ist es doch so, dass sich auch in den Geschichtswissenschaften die Fragen aus unserer gegenwärtigen Situation ergeben. Das Anliegen der Wissenschaftsgeschichte besteht nicht zuletzt darin, Merkmale wissenschaftlicher Erkenntnis und deren Auswirkung auf Gesellschaft anhand historischer Beispiele zu verstehen.
Wie ist es Ihnen gelungen, sich in so kurzer Zeit auf das neue Thema vorzubereiten – noch dazu mit den gegenwärtigen Einschränkungen zum Beispiel in der Literaturversorgung?
Ein Kurs über ein Ereignis, dass sich immer noch so schnell entwickelt, ist ein Experiment. Das ist gleichzeitig Motivation und Herausforderung. Der Berg an Primärquellen wächst täglich und es erscheinen ständig spannende ad-hoc-Analysen. Ich profitiere von der Fachcommunity der Wissenschafts- und Medizingeschichte. Kolleg*innen aus aller Welt haben über soziale Medien diese Inhalte bereits aufbereitet und geteilt. So ist in rasender Geschwindigkeit eine beindruckende Wissensbasis entstanden, mit der auch ich arbeite.
Das Seminar startet am Freitag, dem 24. April – wie ist der Ablauf geplant, wird es Videokonferenzen geben? Ist geplant, die Erkenntnisse des Seminars auch öffentlich zugänglich zu machen?
Dieser Teil ist tatsächlich eine Herausforderung. Genau wie viele Kolleg*innen hatte ich bisher keinerlei Erfahrung in der Onlinelehre. Daher wird der Kurs auch in diesem Sinne ein Experiment. Wir werden uns das Thema in kleinen Aufgaben erschließen. Ich werde jede Woche auch ein Zoommeeting anbieten, das allerdings nur ein freiwilliges Diskussionsangebot sein soll. Eine größere Zahl an Student*innen wöchentlich vor die Kamera zu zwingen, halte ich didaktisch für wenig sinnvoll. Außerdem wurde wir ja vom RZ darum gebeten, die Serverlast niedrig zu halten.
Wie ist die Resonanz seitens der Studierenden? Zeigen sie Interesse daran, sich aus wissenschaftlicher Sicht mit der Pandemie zu beschäftigen?
Die Resonanz auf den Kurs ist sehr gut. Die Mischung aus unterschiedlichen Studiengängen zeigt, dass das Thema ankommt. Ich sehe mich hier auch in meiner Vermutung bestätigt, dass es in der derzeitigen Situation ein gesteigertes Reflektionsbedürfnis gibt, das ich mit dem Kurs bedienen will. Dabei folge ich dem Auftrag, den wir uns in unserem Studiengang gegeben haben. Und ich versuche eine der zentralen Aufgaben zu bedienen, die Universitäten in unserer Gesellschaft haben.