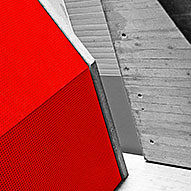Gemeinschaftssinn vs. COVID-19
Psycholog:innen untersuchen, was für die Akzeptanz von Corona-Maßnahmen entscheidend ist
10. Februar 2022
Ein Interview mit Dr. Matthias Hudecek, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Sozial-, Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie, und Professorin Dr. Eva Lermer, bis 2019 ebenfalls wissenschaftliche Mitarbeiterin am Regensburger Lehrstuhl, inwzischen Professorin für Wirtschaftspsychologie (Schwerpunkt Personal und Organisation) an der Hochschule Ansbach.
Herr Dr. Hudecek, Frau Professorin Lermer, Sie sind Ko-Autor bzw. -Autorin einer internationalen Studie, an der über 200 Wissenschaftler:innen aus 67 Ländern beteiligt waren. Die Zahlen deuten bereits an, dass es sich bei dem Studieninhalt um etwas handeln muss, was uns alle angeht – es geht um Corona?
Das stimmt. Die Covid-19 Pandemie hat ein globales Ausmaß und tangiert im Grunde sämtliche Lebensbereiche. Weltweit haben Regierungen Maßnahmen ergriffen, um bei der Bevölkerung Verhaltensänderungen zu bewirken, mit dem Ziel, sie zu schützen. Insbesondere in den ersten zwölf Monaten nach Ausbruch der Pandemie, einer Zeit, in der noch keine Impfstoffe zur Verfügung standen, war das Befolgen der Empfehlungen und Anweisungen der Regierungen, wie etwa das Tragen von Masken an bestimmten Orten oder die Einschränkung von physischen Kontakten essenziell notwendig.
Vor dem Hintergrund dieser außergewöhnlichen Situation hat sich ein internationales Team an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zum Ziel gesetzt, die psychologischen Faktoren von Einstellungen und Verhaltensintentionen im Zusammenhang mit Covid-19 zu untersuchen und besser zu verstehen. Im Fokus stand dabei insbesondere die Frage, in welchem Maße die jeweiligen Bürgerinnen und Bürger die Vorgaben seitens der lokalen Regierungen, physische Kontakte einzuschränken, Hygienevorgaben einzuhalten und politische Maßnahmen zu unterstützen, befolgten und was die Akzeptanz der neuen Maßnahmen besonders fördert. Letztlich waren an dem Projekt über 250 Forscherinnen und Forscher beteiligt und haben Daten aus 67 Ländern gesammelt und ausgewertet.
Was sind die wichtigsten Ergebnisse der Studie?
Ein zentrales Ergebnis ist, dass nationale Identifikation der stärkste positive Prädiktor für die Unterstützung von Maßnahmen ist, die der öffentlichen Gesundheit dienlich sind. TeilnehmerInnen, die eine hoch ausgeprägte nationale Identifikation angeben, sind am meisten bereit, sich an schützende Verhaltensvorgaben zu halten und den politischen Empfehlungen zu folgen.
Wie würden Sie den in der Studie verwendeten Begriff „national identification“ oder auf Deutsch „nationale Identifikation“ umschreiben? Es geht ja ausdrücklich nicht um hierzulande eher negativ konnotierte Begriffe wie Nationalstolz oder Nationalismus?
Genau, das Konstrukt „nationale Identifikation“ meint nicht Nationalismus, kollektiven Narzissmus, nationale Überlegenheitsgefühle oder nationalistische Ideologien. Vielmehr beschreibt nationale Identifikation den Grad, zu dem sich Bürgerinnen und Bürger mit der eigenen Nation identifizieren können. Das ist also etwas positives. In unserer Studie hat sich weltweit gezeigt, dass Personen, die hier höhere Werte angeben, die gesundheitspolitischen Vorgaben stärker unterstützen. Bestätigt werden diese Ergebnisse mittels der Daten einer zweiten Studie. Hierzu wurden die Daten zur nationalen Identifikation aus dem „World Values Survey“ mit von Google erhobenen Mobilitätsdaten aus dem Frühjahr 2020 verglichen. Das Ergebnis: In Ländern, in denen die durchschnittliche nationale Identifikation höher ausgeprägt ist, reduzierten die Bürgerinnen und Bürger ihre Mobilität stärker.
Es klingt erst mal wie ein Widerspruch: Dass „nationale Identifikation“ dabei helfen kann, eine globale Pandemie in Schach zu halten.
Wir denken, dass dies viel mit dem intuitiven Verständnis des Begriffs in Deutschland zu tun hat. Tatsächlich beschreibt das Konstrukt ja weder nationalistisches Denken noch Überzeugungen, dass das eigene Land in irgendeiner Form überlegen ist, sondern zielt vielmehr darauf ab, wie stark man sich mit dem eigenen Land identifiziert. Aus dieser Perspektive ergeben die Ergebnisse dann durchaus ein stimmiges Bild. Wenn man sich als Person stärker mit dem Land verbunden fühlt, in dem man lebt, ist es konsequent, dass man auch eher bereit ist sich auf eine Weise zu verhalten, die der Gesellschaft dienlich ist – auch wenn dies mit individuellen Einschränkungen wie der Reduktion von Kontakten verbunden ist.
Wie haben Sie den Grad der „nationalen Identifikation“ ihrer Probanden gemessen?
Die Messung erfolgte mittels zweier Fragen, die aus etablierten Instrumenten entnommen wurden. Auch die anderen Fragen wurden sämtlich aus fundierten Messverfahren übernommen. Die Teams der einzelnen Länder haben die Fragen dann in die jeweilige Landessprache übersetzt, falls hierfür noch keine Version vorlag.
Was können wir aus diesen Studienergebnissen lernen?
Grundsätzlich tragen die Erkenntnisse dieser Untersuchung dazu bei, ein besseres Verständnis der Pandemie-Situation zu entwickeln und können dabei helfen, zukünftige Schutzmaßnahmen orientiert an psychologischen Erkenntnissen zu gestalten und damit zu optimieren. Die Ergebnisse dieser Studie verdeutlichen dabei nochmal die Bedeutung des Zusammengehörigkeitsgefühls.
Wer wurde für die Studie befragt und wie haben Sie Ihre Probanden ausgewählt?
Für die Studie wurden Daten von fast 50.000 Personen aus 67 Ländern erhoben. Die Befragung erfolgte mittels eines Online-Fragebogens, wobei für jedes Land bei den befragten Personen auf eine repräsentative Verteilung hinsichtlich Alter und Geschlecht geachtet wurde. Neben der globalen Perspektive der Studie ist dieser Faktor der Repräsentativität besonders hervorzuheben, weil dadurch die Aussagekraft der Ergebnisse nochmals gesteigert wird. Gerade in der Psychologie wird bei Online-Studien häufig mit Gelegenheitsstichproben gearbeitet, deren Ergebnisse nur bedingt verallgemeinerbar für die Bevölkerung sind, da beispielsweise oftmals Studierende befragt werden. Dieses Problem gibt es bei der vorliegenden Untersuchung folglich nicht.
In welchem Zeitraum wurden die Ergebnisse erhoben bzw. für welchen Zeitraum sind die Ergebnisse aussagekräftig? Und um welche Gesundheitsmaßnahmen geht es, Hygienemaßnahmen, Kontaktbeschränkungen oder auch umstrittene Maßnahmen wie Lockdowns, Ausgangssperren oder Impfangebote?
Die Befragung fand im Zeitraum von April bis Mai 2020 statt, also während der “ersten Welle”. Zu dieser Zeit befanden sich die meisten Länder noch im Lockdown bzw. es galten in der Regel strenge Beschränkungen. Der Fokus der vorliegenden Untersuchung war recht breit angelegt. D. h. die Personen wurden sowohl hinsichtlich ihres Verhaltens zum Thema Kontaktbeschränkungen als auch zu Hygienemaßnahmen und ihren Einstellungen gegenüber den politischen Entscheidungen befragt. Beim letzten Block, also den politischen Entscheidungen, ging es dann auch um kontroverse Themen wie die Schließung von Schulen, Bars und Restaurants oder die Einschränkung von Reiseaktivitäten. Die Einstellung gegenüber Impfungen war nicht Teil der Studie, da zum damaligen Zeitpunkt noch nicht absehbar war, wann ein Impfstoff verfügbar sein würde.
Gibt es in Ihrem Fachbereich häufiger Studien mit so vielen Ko-Autoren und der Zusammenarbeit in so vielen Ländern? Wie wurde das Ganze koordiniert?
Tatsächlich ist die Art und Weise, wie diese Studie entstanden ist, besonders – und in Anbetracht der Tatsache, dass es sich um ein globales Projekt mit über 200 WissenschaftlerInnen handelt, aus unserer Sicht, einzigartig. Im April 2020, also relativ zu Beginn der Pandemie, zu einer Zeit als es noch keinen Impfstoff gab, rief der US-amerikanische Forscher Jay Van Bavel von der New York University weltweit Kolleginnen und Kollegen über Twitter zu einer Studie auf. Diese Studie hatte zum Ziel, repräsentative Daten aus möglichst vielen Ländern zusammenzutragen, um in Erfahrung zu bringen wie Menschen auf die Covid-19-Maßnahmen reagieren und welche Variablen sich hier als förderlich erweisen. Dem Aufruf Van Bavels folgten schließlich mehr als 250 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus der ganzen Welt.
Informationen/Kontakt
Das Forschungsteam stellt sich und das Projekt auf seiner Projektseite sowie in einem Blogbeitrag von Flavio Azevedo auf Nature-Blog vor und berichtet ausführlicher über die Ergebnisse ihrer Untersuchung im renommierten Wissenschaftsjournal Nature Communications.