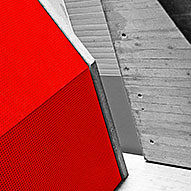Rütteln, bis das Regime stürzt
Dr. Olga Shparaga bei der Graduiertenschule für Ost- und Südosteuropastudien (UR) über Belarus, Solidarität und Schwesterlichkeit
13. Februar 2023
100 Tage lang gingen Tausende Belarus*innen nach den Präsidentschaftswahlen in ihrem Land am 9. August 2020 auf die Straße: Ein gewaltiger, erster Protest, den eine „sozial-politische Emanzipation“ auszeichnete und der weltweit zu den größten pro-demokratischen Mobilisierungen der letzten Jahrzehnte gehörte. Eine besondere Rolle dabei spielten Frauen völlig unterschiedlicher Gesellschaftsschichten und politischer Anschauungen, die sich in nur wenigen Tagen landesweit organisierten und eine Gruppe am Koordinationsrat bildeten, der die Protestierenden kreativ, friedlich, horizontal lenkte.
„Es ging uns darum, einen Dialog-Raum aufzubauen“, sagt Dr. Olga Shparaga, Mitglied dieses Koordinationsrates, Professorin für Philosophie, Autorin, Aktivistin: „Es ging viel weniger um Änderung des Regimes als um die Emanzipation der Gesellschaft. Durchbruch lässt sich nur erreichen, wenn die einfachen Menschen ihn mittragen“. Am 1. Februar 2023 sprach sie bei der Graduiertenschule für Ost- und Südosteuropastudien (GS OSES UR) der Universität Regensburg über die mit den Protesten entstandene Stimmung in Belarus, über Schwesterlichkeit, die etwas anderes ist als Brüderlichkeit, über eine nicht verschwundene, „fürsorgliche, postnationale Solidarität“: „Es ging und geht uns nicht um persönliche Ambitionen. Es geht um das Interesse der Gesellschaft.“
 August 2020 in Belarus. Foto: Olga Shparaga
August 2020 in Belarus. Foto: Olga Shparaga
Im Interesse der Gesellschaft
Es sei besonders der Ton Shparagas, sagt die Gleichstellungsbeauftragte der GS OSES (UR), Professorin Dr. Sabine Koller, die gemeinsam mit ihrer Stellvertreterin, Professorin Dr. Julia Herzberg, durch die Veranstaltung führt. „Ruhig, klar, souverän, solidarisch, dem Nächsten zugewandt“. Tatsächlich ist es eine intellektuelle, warme Nüchternheit, die Shparagas Vortrag ebenso wie ihre Bücher auszeichnet. Sie ist eines der zentralen Gesichter der vorwiegend weiblichen belarusischen Oppositionsbewegung, die 2020 auf die Straßen ging und gegen das Regime Lukaschenka protestierte. Olga Shparaga spricht über Solidarisierung, Fürsorglichkeit und Schwesterlichkeit als Bezugspunkt politischen Lebens. Diese Schwesterlichkeit hat nichts mit Opferdasein oder Heldentum zu tun, aber mit Handlungsfähigkeit, Beteiligung, Inklusion. Topoi, die den Vortrag begleiten.
Zu Beginn zitiert Olga Shparaga den belarusischen Wissenschaftler Sjargej Garanin, der Ende November 2022 sagte: „Das Leitmotiv des emotionalen Lebens der Menschen unter diesen Bedingungen ist es, sich zu verstecken, nicht Teil des Systems zu werden, nicht entmenschlicht zu werden.“ Es ist dieses eine Mal in ihrem einstündigen Vortrag, dem eine ebenso lange Fragerunde folgt, in dem Olga Shparaga für einen winzigen Moment die Fassung verliert, und es ist bei eben diesem Zitat, als sie vom Schicksal einer Freundin berichtet: „Es gibt immer noch Widerstand. Das Jahr 2020, das, was es damals gab – gegenseitige Hilfe, Solidarität, Menschlichkeit – das ist alles noch da, es ist nur in den Gefängnissen geschlossen. Geschlossen, aber erhalten.“
 Dr. Olga Shparaga Anfang Februar 2023 bei der Graduiertenschule für Ost- und Südosteuropastudien an der Universität Regensburg. Foto: Gesa Morina/GS OSES (UR)
Dr. Olga Shparaga Anfang Februar 2023 bei der Graduiertenschule für Ost- und Südosteuropastudien an der Universität Regensburg. Foto: Gesa Morina/GS OSES (UR)
Verfolgung, Lager, Folter
Die Fähigkeit, solidarisch zu sein und zu bleiben, über die 2020er Proteste hinaus, ist Shparaga, die nach Verhaftung und 15 Tagen im Gefängnis im Oktober 2020 Minsk verließ, in jedem Satz ein Anliegen. Stolz auf den Widerstand der Frauen, der alle gesellschaftlichen Schichten umfasst, auf die Arbeiterinnen und Akademikerinnen, auf die „Revolution mit weiblichem Gesicht“ schwingt in dem klaren Vortrag der Aktivistin ebenso mit wie die Angst, belarusische Truppen könnten in den Krieg Russlands gegen die Ukraine eintreten.
Es sind dramatische Zahlen, die sie nennt: Mehr als 1400 Menschen gelten heute als politische Gefangene in Belarus, mehr als 40.000 Menschen wurden nach den Protesten verfolgt, an die 11.000 Strafverfahren wurden eingeleitet, über 6000 Menschen werden nur in den ersten drei Tagen nach den Präsidentschaftswahlen am 9. August 2020 bei den Protesten festgenommen. Die Verhaftungen und die Verfolgung der Protestierenden gehen bis heute weiter. Allein im Januar 2023, zitiert Shparaga die belarussische Menschenrechtsorganisation Viasna, gab es 350 politisch motivierte Festnahmen und 44 Verurteilungen. Denen, die das Land verlassen haben, wie Shparaga, die nach zwei Jahren am Wissenschaftskolleg in Berlin nun am Institut für Lebenswissenschaften in Wien tätig ist, droht der Entzug der belarussischen Staatsbürgerschaft. An die 1100 Nichtregierungsorganisationen in Belarus wurden bereits geschlossen, 700 warten noch darauf. Lagerhaft und Folter, Säuberungen wie in der Sowjetunion der 1930er Jahre, sagt Shparaga, seien die Gegenwart in Belarus.
"Wir sind unglaublich!"
„Wir werden kämpfen, wir werden die Gesellschaft mobilisieren!“ ist das Leitmotiv, das Shparaga und ihre Mitstreiter*innen antreibt. Zu Hilfe kamen im Sommer 2020 Menschenrechtsaktivisten aus aller Welt, die die Aktivistinnen mit IT unterstützten. Die Technologien ließen sich nutzen: Verschlüsselte Social-Media-Kanäle halfen beim „horizontalen Handeln“. Um Leadership ging es den Aktivistinnen nicht. Die Gesellschaft habe sich extrem schnell vernetzt, berichtet Shparaga, „es kam auch für mich überraschend“. Auch für die belarusischen Sicherheitskräfte: „Sie wussten nicht, was sie tun sollten“, als die organisierten Märsche von Student*innen, Lehrer*innen, Ärzt*innen, Arbeiter*innen, nur wenige Tage nach der Wahl begannen und die Frauen an der Spitze sich zu Vorbildern für Widerstand entwickelten. LGBTQ-Gruppen schlossen sich den Protesten an, berichtet Shparaga, ebenso wie Rentner*innen und Menschen mit Handicap. „Es ging um eine Form des politischen Lebens, die Menschen öffneten sich.“
 August 2020 in Belarus. Foto: Olga Shparaga
August 2020 in Belarus. Foto: Olga Shparaga
In den Gefängnissen entwickelte sich das für Shparaga entscheidende Moment der Schwesterlichkeit ganz besonders, fand seinen individuellen Ausdruck: Gegenseitige Unterstützung, Teilen – von Materiellem, von Kenntnissen. Shparaga erinnert an ihre Kollegin Maria Kolesnikova, die ihren Pass zerriss, als sie aus ihrem Land vertrieben werden sollte und seit 7. September 2020 eingesperrt ist. „My neveroyatnye“ lautete ihre eindringliche Losung: „Wir sind unglaublich!“ Unglaublich auch, dass die Geschichte, die Mythen der Vergangenheit, für die Aktivist*innen aktuell kein Thema sind. Es geht nicht um die Narrative hinter den Flaggen und Symbolen: „Uns geht es um Gegenwart und Zukunft“, sagt Shparaga. Es brauche neue Werte: „eine neue, lebendige, inklusive Form der Gemeinschaft“.
Anfang 2023 gebe es in Belarus zunehmend weniger Räume für Widerstand und Proteste, berichtet Olga Shparaga. Der Druck sei wieder höher geworden: Wohnungen werden durchsucht, Nachbar*innen zum Denunzieren aufgerufen, Führungskräfte in Fabriken, Schulen, Universitäten ausgetauscht. Und es werde in Lagern gefoltert. Shparaga erzählt von Frauen, die auf die Straßen gingen und nun inhaftiert sind, wie Danuta Peradnia, Natalia Dulina oder Marfa Rabkova. Wie lässt sich jenen helfen, die in Belarus inhaftiert sind, lautet eine Frage aus dem vorwiegend weiblichen, vielfach studentischen Publikum. „Berichten Sie nicht nur über das autoritäre Regime, sondern über die Frauen in Belarus, schreiben Sie über sie, schreiben Sie ihnen Briefe“, empfiehlt Shparaga. Es geht um das Verinnerlichen und Leben einer fürsorglichen, postnationalen Solidarität – nicht nur in Belarus.
twa.
Informationen/Kontakt
Zu Dr. Olga Shparaga
Zu den zitierten Informationen der belarusischen Menschenrechtsorganisation Viasna