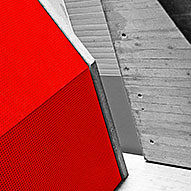Die Wiederkehr der Narrative
Covid-19 aus Perspektive der multiskalaren Area Studies – Rückschau auf eine dreitägige internationale Konferenz an der Universität Regensburg
24. Juni 2022
Simple Ideen, Botschaften, Geschichten, die die Welt erklären – Menschen brauchen Sinnstiftung. Insbesondere, wenn es kompliziert zu werden droht. Besonders wirksam sind Geschichten, wenn sie Gefühle ansprechen, besonders effektiv, wenn das unbewusst passiert und in unseren Köpfen eine neue Realität konstruiert. Solche Geschichten, Narrative, helfen, sich gesellschaftlich einzuordnen, den eigenen Platz in einer immer komplexer werden Welt zu verorten. Sie zeigen Lösungen im Strudel von Hilflosigkeit – insbesondere in Krisenzeiten. Eine internationale Konferenz an der Universität Regensburg (UR) setzte sich unlängst drei Tage lang mit der Vielfalt von Krisennarrativen auseinander, die die COVID-19-Pandemie begleiteten und begleiten. Veranstaltet wurde die Tagung vom Center for International and Transnational Area Studies (CITAS) der Universität Regensburg und dem Leibniz-WissenschaftsCampus (LWC) Europa und Amerika, eine gemeinsame Einrichtung der UR und des Leibniz-Instituts für Ost- und Südosteuropaforschung (IOS) in Regensburg.
Pandemie, Krieg, Verschwörung
Eigentlich hatte die Postmoderne das Thema Narrative schon abgehakt und François Lyotard zu den literarischen Akten gelegt. Aber zu Recht? Jochen Mecke, Lehrstuhlinhaber für Romanische Philologie an der Universität Regensburg und derzeit CITAS-Sprecher, zweifelt daran, skizziert hiervon ausgehend die Fragestellung der Konferenz, die UR-Präsident Professor Dr. Udo Hebel eröffnet. COVID-19 gehört zu den Ereignissen der jüngsten Vergangenheit, die Narrative wiederbelebt und mit Legitimität ausgestattet haben. Welche Narrative hat die Pandemie geschaffen? Welche Funktion haben sie übernommen, welche Effekte verursacht? Anelia Kassabova von der Universität Sofia konstatiert zu Beginn der Konferenz die Vermengung der Pandemie-Narrative mit denen des Kriegs in der Ukraine. Skurril anmutende Geschichten tauchten während COVID-19 auf - Impfgegner:innen, die sich mit Anti-Nato-Bewegten vereinen; nationalistische Kräfte, die Hygienegebote zur Infektionsvermeidung zum Nachweis dafür benutzen, dass liberale Kräfte den orthodoxen Glauben angreifen. Miloš Jovanović von der serbischen Universität Niš berichtet von bizarren Auseinandersetzungen um die Nutzung des immer gleichen Löffels im Rahmen der Eucharistiefeier in serbisch-orthodoxen Kirchen.
Ein Moment, das insbesondere im östlichen Europa zum Tragen kommt, scheint ein gewachsener Vertrauensverlust in staatliche Institutionen zu sein. Die Historikerin und Germanistin Kassabova sieht das als Schlüsselmoment nicht nur für Bulgarien, sondern für weite Teile Südost- und Osteuropas. Für Gábor Egry, Direktor des Bundapester Instituts für Politische Geschichte, liegt die Ursache dieses Verlustes 30 Jahre zurück, er vermutet sie in den vielen missglückten Transformationsprozessen nach dem Zusammenbruch von Kommunismus und Sowjetunion. Man habe vielerorts nicht die Fähigkeit besessen, mit solchen Krisen klarzukommen, sagt der Forscher, viele Menschen erlebten in den Jahren nach 1990 Gangsterkapitalismus, vermissen heute Governance und soziale Infrastruktur. Die medizinische Versorgung hinke hinterher, nicht zuletzt wegen der Entvölkerung ganzer Landstriche. Kristen Ghodsee und Mitchell Orenstein von der University of Pennsylvania attestieren diese soziale Dramatik in ihrer Keynote, moderiert vom wissenschaftlichen Direktor des IOS, Inhaber des Lehrstuhls Geschichte Südost- und Osteuropas, Ulf Brunnbauer, auch Deutschland: Viele Ostdeutsche hätten dramatische Konsequenzen in den Jahren nach 1989/1990 gespürt. Man habe nur eben immer wenig davon gehört: Denn die DDR trat der Bundesrepublik Deutschland bei und fiel in ihrer vorherigen Verfasstheit als Untersuchungsgegenstand weg.
Untersuchungen von Önder Küçürkural, Merve Aktar und Rahmi Oruç von der Ibn Haldun Universität in Istanbul betrachten die Verschwörungstheorien im Pandemiekontext in der Türkei. Ihre Interviews mit Studierenden 15 türkischer Universitäten zeigen, dass diese sich nicht zuletzt unter jungen Studierenden breitmachen. Antikapitalismus ist ein immer wieder genanntes Stichwort der dazugehörigen Ursachenforschung. Immer eingeschlossen in die Theorien sind die Pharmaunternehmen, die Impfstoffe produzieren. Viele Jugendliche in Südosteuropa oszillierten in diesen Diskursen zwischen nationalistischen und kosmopolitischen Werten, berichten die türkischen Wissenschaftler:innen.
Framing, Shaming, Blaming
Wie die Narrative der Covid-19-Pandemie das Verhältnis von Staat und Bürger:innen prägen, verdeutlichte ein Panel mit Christopher Ankersen (New York University) und Owen Kohl (University of Chicago), moderiert von der Regensburger Politikwissenschaftlerin Gerlinde Groitl. Ankersen, der mehrere Jahre für die Vereinten Nationen tätig war, analysiert die weltweite Kriegsrhetorik der Pandemie: In Kanada, den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich wurden die „guten Kriege“ bei der Beschreibung der Pandemie-Ereignisse benutzt, Korea oder Vietnam tauchten nicht auf. Medizinisches Personal wird zur Armee der Verteidiger:innen, Ärzt:innen und Pflegepersonal zu den Front-Soldat:innen, die das Böse bekämpfen. Eine Rhetorik, die weltweit Menschen gegenüber dem gemeinsamen Feind Corona eint, dazu geeignet, dass alle die, die den Kampf nicht nach Möglichkeit unterstützen, sich schämen müssen. Krisenstäbe entstehen, in vielen Ländern, so irgendwann auch in Deutschland, wird das Militär geholt und in COVID-betreffende Abläufe involviert. Auch strategisch. Staatliche Macht erfährt neue, andere Grenzen.
Schuldzuweisungen und Rassismus, oft überlappend, machten in den schwierigsten Pandemie-Phasen die globale Runde. Es sind Beschäftigte in Biolaboratorien bis hin zu bestimmten Gruppen von Migrant:innen, die „Karens“, die „Trumpers“, die „Shitlibs“. Nachrichten bekommen ideologische Qualität, resümiert Owen Kohl, die Gesellschaften veränderten sich im Versuch ihrer Mitglieder, sie und sich in besonderer Weise zu gruppieren. Alexander Pittman (Ohio State University) berichtet im Anschluss von Beobachtungen und Gesprächen mit Studierenden of Colour an einem als „Predominantely White Institution“ eingestuften College: Die von vielen Studierenden, insbesondere Studienanfänger:innen, weltweit beklagte und erlebte Einsamkeit in Zeiten ausschließlich digitaler Lehrveranstaltungen verknüpfte sich für Studierende of Colour in den USA vielerorts mit Ängsten vor radikalisierter Straßengewalt, die im Mai 2020 nach dem Tod George Floyds Amerika erschütterten. Einsamkeit potenzierte sich. Digitale Lehre erhielt eine besondere, schwer erträgliche Schutzfunktion.

COVID-19-Winter 2020 an der UR. Foto: Julia Dragan
Räume und ihre Determinanten
Wie verhalten sich die Räume der Pandemie und räumliche Determinanten wie Armut, sozioökonomischer Status, Entwicklung oder (medizinische) Infrastruktur? Yamini Agarwal, Research Fellow am Max Weber Forum for South Asian Studies in Neu-Delhi, betrachtet dazu den Online-Unterricht im Pandemie-Kontext: Als besonders erfolgreich propagiert wurde häufig die Möglichkeit, mit Online-Unterricht gleiche Chancen für Kinder aller sozialen Schichten zu schaffen. In Indien etwa gelangen Mädchen zwischen 14 und 17 Jahren aus Familien mit wenig Geld und niedrigem Sozialstatus selten bis zur Sekundarschulbildung. Agarwal hat in einer Studie in einem Vorort von Neu-Delhi recherchiert, wie sich dort die Umstellung auf den Online-Unterricht auswirkte und ist auf deprimierende Erkenntnisse gestoßen: Fehlende Infrastruktur macht gleiche Bedingungen für alle Kinder weiterhin unerreichbar. So hat der von Agarwal untersuchte Distrikt Sompur 1,5 Millionen Einwohner:innen, aber nur eine Sekundarschule für 500.000 Kinder. Dort (online) zu lernen, bleibt vielen vorenthalten – daran änderte auch Online-Schicht-Unterricht nichts. Wer vom Online-Unterricht allerdings profitierte, waren einige Tech-Plattformen.
Transregionale Besonderheiten untersucht der tschechische Soziologe Lukáš Novotný. Er stieß in 65 Tiefeninterviews mit Pendler:innen des deutsch-tschechischen Grenzraumes dabei häufig auf Verzweiflung: Das plötzliche Schließen der Grenzen hat viele mental und finanziell erschöpft, die Nachwirkungen bleiben. Programme der Grenzräume, um und in Bayern, Tschechien und Sachsen, wo etwa die Freistaaten Kosten für Übernachtungsmöglichkeiten übernahmen, waren begrenzt erfolgreich – Familien zerrissen, Jobs gingen trotzdem verloren. Die Rolle der Regionen als Akteurinnen der Pandemie und narrative transregionale Räume untersucht auch Nina Pilz von der Universität Greifswald, die die baltische Perspektive eröffnet: Mit der neuen Rolle der Regionen und ihrem Handeln als Entscheidungsträgerinnen der Pandemie gerieten sie auch in den öffentlichen Krisen-Diskurs und werden anhand ihres Krisenmanagements (neu) bewertet: Schweden gehörte zu den markanteren Beispielen.
Gewalt, Gender, Kultur
Krisennarrative scheinen räumliche und soziale Unterschiede oftmals vertieft zu haben. Anne Brüske, die seit dem Wintersemester 2020/21 die Professur »Räumliche Dimensionen kultureller Prozesse« an der Universität Regensburg vertritt, macht das Auditorium mit Graphic Novels aus Chile und Argentinien bekannt. Beide Länder waren von harten und besonders langen Lockdowns getroffen. „El ano de la plaga“ erzählt zehn Geschichten aus verschiedenen sozialen Gruppen, verdeutlichen die Vulnerabilität von Hausangestellten, die in weit von ihrer Heimat entfernten Ländern arbeiten, um ihre Familien zu ernähren.
Gewalt und Aggression gegen Minderheiten, sind ein weiterer Aspekt, den neben anderen Raul Castorcea von der irischen Maynooth University betrachtet. Er beleuchtet die Diskriminierung und Exklusion von Roma-Gemeinschaften in Ost- und Südosteuropa in historischer Perspektive und erkennt dabei sich wiederholende Muster: Diese Communities wurden in Zeiten von Pandemien zum Sündenbock für die jeweiligen Ereignisse gemacht, in den Zeiten der Pest bis zu Cholera- oder Typhus-Ausbrüchen im 19. und 20. Jahrhundert. Einen quasi-optimistischen Schlussakkord setzt Danielle Heberle Viegas von der LMU München mit dem Hinweis auf eine grüne brasilianische Utopie: Wohlhabende Brasilianer:innen verließen während der Pandemie in einem „turn to nature tourism“ die Städte und suchten Zuflucht in gated communities, wo sie sich den Garten Eden der Superreichen schufen.
Narrative sind zurück, „sie erobern die Sozialwissenschaften“, resümiert Jochen Mecke. Er betrachtet gegen Ende der Tagung literarische Be- und Verarbeitung der Pandemie, in der Chroniken und Tagebücher, unter anderem in Spanien und Frankreich, zur bevorzugten literarischen Form wurden. Der große Pandemie-Roman stehe aber noch aus, sagt der Literaturwissenschaftler. Vielleicht, weil den Ereignissen bislang ein Schlusspunkt fehle, vielleicht auch, weil die Pandemie für die meisten nach wie vor keinen Sinn ergebe…
twa.
Informationen/Kontakt
Zu Area Studies an der Universität Regensburg
Zu CITAS
Zum Leibniz-WissenschaftsCampus Europa und Amerika in der modernen Welt
Zum Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung (IOS)