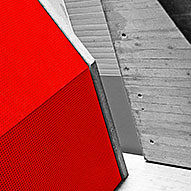Zwischen Gender Studies und Aktivismus
Sozialphilosophin und Aktivistin Dr. Maria Rakhmaninova sprach bei der Graduiertenschule Ost- und Südosteuropa (UR)
22. Dezember 2022
Über linken Feminismus in Russland in den Jahren 2010 und 2022 referierte unlängst die Sozialphilosophin und Aktivistin Dr. Maria Rakhmaninova an der Universität Regensburg. Olga Trufanova, Doktorandin der Graduiertenschule Ost- und Südosteuropa (Universität Regensburg), hatte die Einladung der bis 2022 an der Staatlichen Universität St. Petersburg unterrichtenden Dozentin, die nun im georgischen Tbilisi lebt, initiiert, unterstützt wurde sie dabei von den beiden Gleichstellungsbeauftragten der Graduiertenschule, den Professorinnen Dr. Julia Herzberg (Professur für Geschichte Ostmitteleuropas/Russlands in der Vormoderne der LMU München) und Professorin Dr. Sabine Koller (Professur für Slavisch-Jüdische Studien an der Universität Regensburg). Sie begrüßten die Zuhörer:innen im gut gefüllten virtuellen Hörsaal zum Vortrag „Left Feminism in Russia 2010-2022: Between Gender Studies and Activism“.
Rakhmaninova, die sich deutlich und öffentlich vom russischen Krieg in der Ukraine distanziert, spricht über Gesellschaft, Staat, Anarchismus, Feminismus und Protestbewegungen, die sie auch persönlich dokumentiert. Sie zeigt eigene Fotografien künstlerischer Aktionen und Performances der 2010er Jahre, die Einblick geben in zivilgesellschaftlichen Widerstand, dessen Inhalte und Vertreterinnen selten in die breite Öffentlichkeit dringen. Den Anspruch eines kompletten Überblicks über alle Protestinitiativen dieser Zeit hat Rakhmaninova nicht: „Aber ich will darauf hinweisen, dass sie eine separate Studie verdienen.“
 Die frühen 2010er Jahre, so die Sozialphilosophin, prägten neue Initiativen und Meilensteine in der Entwicklung des insbesondere linken Flügels des russischen Feminismus: Seine sozialistischen Vertreterinnen gehen auf die Straßen; marxistische, trotzkistische Tendenzen werden ebenso sichtbar wie ein neuer Anarcho-Feminismus. Rakhmaninova sieht dies im Kontext zunehmend intensiver und vielfältiger russischer Rezeption internationaler Quellen zur Gendertheorie; parallel dazu verweist sie aber auch auf wachsendes Wissen um Themen wie Migration, Tierschutz, Naturschutz oder soziale Sicherheit. Einen weiteren Grund sieht sie in den sich intensivierenden autoritären Tendenzen der russischen Sozial- und Wirtschaftspolitik der Zeit. Sie berichtet von Festnahmen bei Kundgebungen und Performances, auch von der eigenen.
Die frühen 2010er Jahre, so die Sozialphilosophin, prägten neue Initiativen und Meilensteine in der Entwicklung des insbesondere linken Flügels des russischen Feminismus: Seine sozialistischen Vertreterinnen gehen auf die Straßen; marxistische, trotzkistische Tendenzen werden ebenso sichtbar wie ein neuer Anarcho-Feminismus. Rakhmaninova sieht dies im Kontext zunehmend intensiver und vielfältiger russischer Rezeption internationaler Quellen zur Gendertheorie; parallel dazu verweist sie aber auch auf wachsendes Wissen um Themen wie Migration, Tierschutz, Naturschutz oder soziale Sicherheit. Einen weiteren Grund sieht sie in den sich intensivierenden autoritären Tendenzen der russischen Sozial- und Wirtschaftspolitik der Zeit. Sie berichtet von Festnahmen bei Kundgebungen und Performances, auch von der eigenen.
Kommunikative Hygiene
Eine wichtige Rolle schreibt Rakhmaninova russischen Gender-Theoretikerinnen der 1990er und 2000er Jahre zu, etwa Elena Zdravomyslova oder Anna Temkina. Sie veröffentlichten Textsammlungen, die die Hauptthesen internationaler Autorinnen zusammenstellten „und es der russischsprachigen Gesellschaft endlich ermöglichten, Lücken zu füllen“. Das Ihre taten die in der gleichen Zeit erscheinenden russischen Übersetzungen von Autorinnen wie Simone de Beauvoir, Virginia Woolf oder Judith Butler. Parallel dazu entwickelten sich breitenwirksame Aktivitäten im akademischen und aktivistischen Milieu: Vorlesungen, Filmclubs, Literaturkreise, organisiert von Studentinnen, Dozentinnen, Künstlerinnen. Themen wie sexualisierte Gewalt oder Belästigung wurden nun diskutiert und schufen neues Selbstbewusstsein: „Erstmals gab es kommunikative Hygiene gemeinsamer politischer Räume“.
Die „Abstraktheit“ des Feminismus
Ein wichtiges Merkmal des linken Feminismus ist laut Rednerin seine Abstraktheit: „Er vereinte sozialistische, kommunistische, anarchistische und sogar bolschewistische Frauen.“ Was ihnen fehlte, sei theoretischer Hintergrund gewesen, glaubt Rakhmaninova, nicht zuletzt ob existentieller Probleme. Wer mehrere Jobs hat, um die Familien zu ernähren, hat wenig Zeit für Theorie. Vielleicht auch deshalb blieb die Zahl der Aktivistinnen in den politischen Protestbewegungen gering. Doch Einigkeit herrschte im Hinblick auf eine gemeinsame, viel breitere zivilgesellschaftliche Agenda: Sie umfasst den Kampf gegen die Diskriminierung arbeitender Frauen, gegen die desolate Situation von Migrantinnen ebenso wie gegen die Abholzung von Wäldern in Naturschutzgebieten. Nicht zuletzt auch gegen das politische Regime.
Rakhmaninovas Überblick über die "all-linke" Agenda 2010 zeigt deren Breite: Die „Russische Sozialistische Bewegung“ etwa, in der sich Frauen in verschiedenen russischen Städten solidarisierten und regelmäßig verhaftet wurden. Sie gingen regelmäßig gegen konservative Gesetze und gegen Einschränkungen der Internet-, Presse- und Redefreiheit auf die Straße und artikulierten sich gegen die Diskriminierung von Frauen. 
Fotos: Maria Rakhmaninova
Vergleichbare Themen hatte „SocFem“, die sich für Arbeiter:innenrechte und gegen sexuelle und häusliche Gewalt einsetzte. Oder Rhythm of Resistance, ein weltweites Netzwerk von etwa 75 Percussionsbands mit besonderen Aktionen und einem basisdemokratischen Grundverständnis. Einen ebenfalls besonderen kreativen Ansatz hatte „Shvemi“, eine Künstler:innen-Kooperative , die Kunst, Aktivismus und Handarbeit kombinierte und mit „politischen Kunstobjekten aus textilen Materialien“ an Nachhaltigkeit und Umweltzerstörung erinnerte. Die Rednerin geht auf einzelne Künstlerinnen ein, die vom russischen Regime als „ausländische Agentinnen“ kriminalisiert wurden, stellt weitere Projekte vor: „Eva’s Ribs“, „Feminfoteka“, „LeftFem – AnFem“ und das 2018 gestartete Journal Akrateia, ein zweisprachiges ukrainisch-russisches Projekt, das nach wie vor existiert.
Die Ukraine als Wendepunkt
Eine gewisse Tragik birgt für Rakhmaninova die Tatsache, dass die Ukraine zu einem „Hauptstolperstein“ in der Uneinigkeit der zahlreichen Frauengruppen geworden ist. Die Meinungen sind gespalten, die Gruppen drifteten auseinander, manche zerbrachen an internen Konflikten. Die russische Invasion im Donbass, die Annexion der Krim, der Rolle der NATO – hier scheiden sich die politisierten Geister, manche sahen neue „Klassenkriege“, erzählt Rakhmaninova, andere nahmen an rigoros von der Polizei zerschlagenen Anti-Kriegs-Protesten teil. „Die russische Aggression in der Ukraine ist zu einem entscheidenden Wendepunkt zwischen Aktivistengruppen und einzelnen Aktivisten geworden“, sagt die Rednerin.
Rakhmaninovas Fazit: „Es wäre keine Übertreibung zu sagen, dass in all diesen Jahren in Russland eine Polyphonie von Reflexionen und den von ihnen inspirierten Protestpraktiken aufgeblüht ist, die den aufziehenden Wolken der Putin-Diktatur entgegenwirkten.“ Im weitesten Sinne spiele der linksorientierte Feminismus, der die größte Sensibilität für die ganzheitlichen Zusammenhänge zeige, in die die Frauenagenda eingebettet war, eine wichtige konstruktive Rolle in dieser Polyphonie und wirkte auch auf soziale Prozesse. Gleichzeitig sieht Rakhmaninova deutlichen Einfluss feministischer Trends auf die politischen und zivilgesellschaftlichen Bewegungen der vergangenen 12 Jahre - insbesondere auf der Ebene des Diskurses. „Es gab einen großen Schritt auf dem Weg zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit. Es ist unanständig geworden, patriarchale und sexistische Stereotypen und Muster offen zu verteidigen.“ Dieser Trend habe zu Solidarität und nicht zuletzt der Beteiligung von Frauen in der Protestbewegung beigetragen.
Die erste Welt…
Aber: „Diese Prozesse blieben für Europa unsichtbar.“ Aktivistengruppen hätten sich nach Europa gewandt, sagt Rakhmaninova, insbesondere nach der Annexion der Krim. „Wir haben Europa aufgefordert, Putins System zu boykottieren und nicht zu unterstützen, wir haben das ganze Wochenende auf Plätzen, in Polizeigewahrsam und in Polizeistationen verbracht - auch nachdem es lebensbedrohlich wurde und die Folter systematisch begann.“ Doch die Botschaft habe „die erste Welt nicht erreicht und wir blieben in einer Art hermetischer zweiter Welt, in der akademische offene Aufrufe und Ankündigungen aktivistischer Veranstaltungen selten ankamen“.
In Verbindung mit der größtenteils passiven Gesamtbevölkerung Russlands sei es nur natürlich, dass dies zu einem totalen Scheitern geführt habe. Gibt es noch einen Ausweg aus diesem katastrophalen Zustand? Rakhmaninova nennt die Unterstützung der Ukraine. Und sie plädiert – „für eine weltweite Solidarität aller Gegner imperialer Modelle und Anhänger:innen von Freiheit und Gerechtigkeit, für gegenseitige Sensibilität selbst in Situationen, in denen die Trägheit vergangener Ordnungen es schwierig macht, zu hören“.
twa.
Informationen/Kontakt
Die Aufzeichnung des Vortrags steht demnächst in der UR-Mediathek zur Verfügung.
Journal Akrateia ukrainisch, russisch
Im Rahmen des Gleichstellungsprogramms der GS OSES (UR) bieten deren Frauenbeauftragten in jedem Semester entweder einen genderbezogenen akademischen Vortrag oder einen an praktischen Fragen orientierten Workshop (z. B. zu gendergerechtem Sprachgebrauch im kommenden Semester) an. Alle Interessierten sind dazu eingeladen.
Informationen zur Graduiertenschule Ost- und Südosteuropastudien und zu deren Genderkonzept
Ansprechpartnerin für die GS OSES (UR): Dr. Heidrun Hamersky, heidrun.hamersky@ur.de
Gleichstellungsbeauftragte der GSOSES (UR):: Prof. Dr. Sabine Koller sabine.koller@ur.de, Stellvertreterin: Prof. Dr. Julia Herzberg, julia.herzberg@ur.de