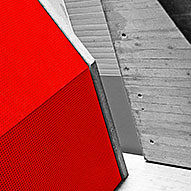Not quite white yet?
Professorin Dr. Claudia Sadowski-Smith über The New Immigrant Whiteness
14. Juni 2022
Whiteness Studies und Migration Studies müssen aus Sicht von Professorin Dr. Claudia Sadowski-Smith (Arizona State University) künftig viel stärker gemeinsam gedacht werden. In ihrem gut besuchten Vortrag am REAF, dem Regensburg European American Forum an der Universität Regensburg, skizzierte die derzeitige Gastprofessorin des Leibniz WissenschaftsCampus (LWC) und Autorin von „The New Immigrant Whiteness“ unlängst, wie die USA und verschiedene europäische Staaten Geflüchteten aus verschiedenen Teilen der Welt begegnen. Schutzsuchende werden unterschiedlich aufgenommen – auch im Hinblick auf ihre rechtlichen Möglichkeiten und dem, was ihnen die Staaten an Möglichkeiten gewähren. Abhängig ist dies häufig vom „Weiß-Sein“, der Whiteness der Migrant:innen und den Konnotationen, die man dieser zuschreibt. Aber – auch Whiteness hat Nuancen.
In zahlreichen Publikationen hat Claudia Sadowski-Smith die Migration in die Vereinigten Staaten von Amerika aus vergleichender Perspektive beleuchtet, unter anderem den Umgang mit Migrant:innen aus dem postsowjetischen Raum. Aus Sicht Sadowski-Smiths müssen US-amerikanische und europäische Forschung künftig Whiteness Studies in Migrationsstudien viel stärker berücksichtigen als bisher. Wie Geflüchtete aus Syrien, Afghanistan oder Sub-Sahara-Afrika 2015 an den Grenzen zu den USA und zur EU empfangen wurden, unterscheidet sich stark von dem, wie man postsowjetischen und mittel-/osteuropäischen Immigrant:innen begegnet. Hängt der Erhalt von Rechten für Migrant:innen und Geflüchteten und auch der US-amerikanischer Staatsbürgerschaft davon ab, wie „weiß“ man ist? Und wie relevant ist Whiteness in Europa?
 Die in diesen Monaten aus der Ukraine Flüchtenden sind für Sadowski-Smith exemplarisch. So verlängerte man in den USA das sogenannte Lautenberg-Programm für postsowjetische Migrant:innen, das ab 1989 Menschen aus historisch verfolgten Religionen die Einwanderung eröffnete, sofern sie Familie in den USA hatten.
Die in diesen Monaten aus der Ukraine Flüchtenden sind für Sadowski-Smith exemplarisch. So verlängerte man in den USA das sogenannte Lautenberg-Programm für postsowjetische Migrant:innen, das ab 1989 Menschen aus historisch verfolgten Religionen die Einwanderung eröffnete, sofern sie Familie in den USA hatten.
Etwa 300.000 Menschen jüdischen Glaubens verließen laut Sadowski-Smith im Rahmen dieses Programms den postsowjetischen Raum in Richtung USA. Nun können Ukrainer:innen das Programm bis Ende September 2022 nutzen. Ein aktuelles und speziell geschaffenes humanitäres US-Programm nennt sich „United for Ukraine“ und offeriert Ukrainer:innen zweijährige Aufenthalts- und Arbeitsvisa in den USA.
Foto: twa/UR
Diese Programme werden in der gesellschaftlichen Debate oft so aufgenommen, als passten sie in die Tradition des Umgangs mit Migrant:innen aus Süd- und Osteuropa. Im Gegensatz zu Migrant:innen aus Asien war es europäischen Migrant:innen in der Regel möglich, die amerikanische Staatsbürgerschaft zu erhalten, und sie fanden bessere Arbeit als African Americans. Europäer:innen wurden zwar schlechter bezahlt als gebürtige Amerikaner:innen und auch sozial und kulturell als „noch nicht komplett weiß“ benachteiligt, doch wurden sie, und vor allem ihre Kinder, nach dem Zweiten Weltkrieg „ganz weiß“, da ihre sozio-ökomische Mobilität durch Programme des wachsenden Sozialstaats gefördert wurde – mehr als die anderer Amerikaner:innen, erläutert Sadowski-Smith.
Mechanismen der Integration
Insgesamt, so resümiert die Forscherin, „passen“ Ukrainer:innen also in die „US Whiteness“ – ihre Hautfarbe spiegelt vermeintlich europäische Identität. Wenigstens werden sie von EU-Europäer:innen und US-Amerikaner:innen mit europäischen Wurzeln so wahrgenommen. Oder doch nicht? Ein Blick auf die letzten Jahre zeigt ein differenziertes Bild und Polemik über die „cultural otherness“ auch weißer Migrant:innen. Sadowski-Smith skizziert zwei Beispiele: In der Brexit-Debatte mokierten sich EU-Gegner:innen mit rassistischen Bemerkungen über die von polnischen Maniküren und Klempnern verursachte Last auf dem britischen Sozialsystem; die Bundesrepublik Deutschland half, auf dem Bau Arbeitskräfte aus Rumänien und Bulgarien anzuwerben und vernachlässigte dabei das Regeln arbeitsschutzrechtlicher Fragen. Außerdem: „Im amerikanischen Kontext ist der Sozialstaat geschrumpft, der die Integration, oder das ‚whitening‘ der europäischen Immigranten im letzten Jahrhundert gefördert hat, so dass die Mechanismen der Integration sich auch für osteuropäische Migranten geändert haben“, sagt die Wissenschaftlerin.
Vielfältige Zusammenhänge
In den USA sieht Claudia Sadowski-Smith ähnliche Phänomene und hat bei zahlreichen Interviews mit Migrantinnen aus dem post-sowjetischen Raum viel Überraschendes gelernt, wie sie sagt. Viele zogen zunächst nach Westeuropa und verließen es wieder in Richtung USA, wo sie sich „in their category of whiteness“ stärker an- und aufgenommen fühlten. Nach wie vor werde im Hinblick auf die Akzeptanz dort wenig zwischen gebürtigen Amerikaner:innen und Greencard-Holdern unterschieden, vor allem wenn sie als „weiß“ empfunden werden. Auch der American Dream – wer hart genug arbeite, schaffe es, auch soziale Mobilität zu erlangen – lebe „als Ideologie“ weiter. Doch sozial mobil zu werden, Vorurteile abwehren und sich problemlos in den „weißen Mainstream der Europäischstämmigen“ integrieren, können viele offenbar auch in den USA nicht, vor allem, weil sich seit der letzten Jahrhundertwende vieles in Sachen Kapitalisums und Sozialstaat geändert habe. Sadowski-Smith zitiert das Postulat der Migrationsforscherin Miri Song, die dazu auffordert „the changing configurations of migration and race“ viel stärker zu berücksichtigen und künftig die Zusammenhänge von Migrationsstatus, Ethnizität, Nationalität und geopolitischen Faktoren mehr in den Blick zu nehmen, vor allem in Hinsicht auf die großen Zahlen von Migrant:innen aus Europa und Eurasien.
Zu Claudia Sadowski-Smiths Resultaten ihrer Untersuchungen im Bundesstaat Arizona gehört unter anderem, dass Teile der postsowjetischen Diaspora für mexikanische Migrant:innen hohe Empathie verspüren – unter anderem wegen der komplexen Rechtslage, in der viele mexikanische Migrant:innen sich befinden, aber auch im Hinblick auf ihre staatliche Überwachung, die viele an persönliche Erlebnisse im (post-)sowjetischen Raum erinnern. Große Stolpersteine für Migrant:innen waren die in der Zeit der Trump-Administration gewachsene Anti-Immigrations-Bewegung, in deren Gegenzug auch viele Aktionsgruppen für die Rechte von Immigrant:innen entstanden, wofür sich auch Teile der postsowjetischen Diaspora engagieren.
Transnationale Realität
Der Vortrag und die anschließende lebhafte Diskussion, moderiert von REAF Administrative Manager Tamara Heger, machen deutlich, wie viele Fragen der komplexe Zusammenhang von Whiteness und Migration neu stellt, auch im Hinblick auf kulturelle und Gender-Aspekte. Professorin Dr. Julia Faisst, Vertreterin des Lehrstuhls für American Studies, erinnert daran, dass die ukrainischen Geflüchteten derzeit vorrangig Frauen und Kinder sind. Claudia Sadowski-Smith stimmt zu, ergänzt, in den USA sei das Wissen darum noch gar nicht angekommen. Und wie sieht es mit der postsowjetischen Migrationskultur aus?
Die Forscherin hat dazu unter anderem Reality-TV und Unterhaltungsshows kontextualisiert und gibt Beispiele. Ein Resümee ihres Ansatzes ist, dass keine „pan-european whiteness“ existiert, sondern transnationale Realität das Leben der Migrant:innen kennzeichnet. Das widerspreche dem gängigen Paradigma, dass „ethnisch europäische“ Einwander:innen dazu neigten, die Bindungen zu ihren Heimatländern aufzugeben und damit gewissermaßen „echte Amerikaner:innen“ zu werden. Vielmehr halten sie umfangreiche Verbindungen in ihre Herkunftsländer aufrecht, investieren in diesen ihr in den USA verdientes Einkommen und pflegen ihre Muttersprachen und Kulturen intensiv – Aspekte, die nicht-weißen Migrant:innen häufig vorgeworfen würden.
Informationen/Kontakt
Zu Professorin Dr. Claudia Sadowski-Smith
Zu REAF – Regensburg European American Forum